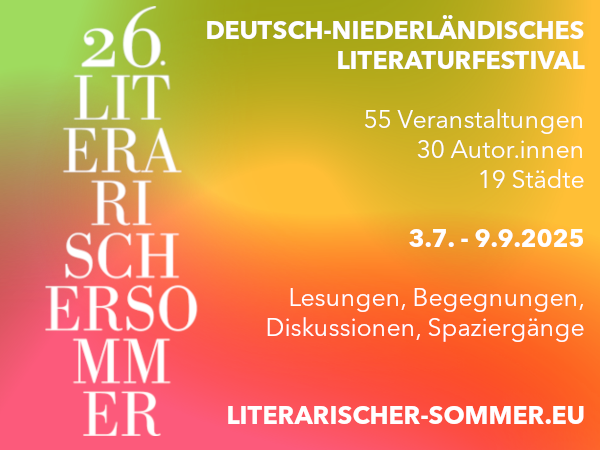// Berühmt wurde er 1958 mit »The Americans«, der fotografischen Musterung eines ganzen Landes, das er zuvor zwei Jahre lang durch- reist und von dessen Orten und Menschen er beinah 30.000 Bilder aufgenommen hatte: der damals gut 30-jährige Fotograf Robert Frank. Ge- boren und ausgebildet worden war Frank in der Schweiz; in die USA auszuwandern hatte der Sohn jüdischer Eltern 1947 beschlossen, rasch war es ihm in New York gelungen, Fuß zu fassen, er hatte eine Ausstellung seiner Fotos und arbeitete für Harper’s Bazaar. Seines künftigen Amerikanertums sicher muss er um jene Zeit dennoch nicht gewesen sein, denn in den Jahren nach 1948 reist Frank durch Südamerika und immer wieder zurück nach Europa, wo er bis 1952 vor allem eine Stadt fotografiert: Paris. Frank flaniert durch die Straßen, aber es ist nicht die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, deren mondäne Reize er einfängt, es ist die zwar unzerstörte aber erschöpfte Weltkriegsüberlebende, die er in beiläufig wirkenden, in Wahrheit sehr genauen Lichtbildskizzen konterfeit: die große Stadt der kleinen Leute, die Kapitale eines öffentlichen Lebens auf schmalen Straßen, in Regen, Kälte, Dunst. Eine Gesellschaft von Schutzsuchenden, eine Stadt baulicher und sozialer Separées.
Gut 70 Fotografien hat die Leiterin der Fotografischen Sammlung des Museums Folkwang, Ute Eskildsen, gemeinsam mit dem immer noch in New York sowie im kanadischen Neuschottland lebenden Robert Frank aus dessen Besitz zusammengetragen; einige dieser Aufnahmen sind weltberühmt, andere hingegen in Essen zum ersten Mal zu sehen.
Menschen von hinten, sehr oft: Ein Straßenkehrer fegt mit dem Reisigbesen den Rinnstein rund um einen leeren Denkmalsockel, ein anderer Mann eilt davon, den Mantelkragen hochgeschlagen, eine genauso dunkel verschlossene Gestalt wie die sich entfernenden hohen Vorkriegsautomobile. Oder: Ein altes Paar, das langsam allein durch einen leeren Park (die Tuile- rien?) geht, der Mann auf einen Stock gestützt, die Frau einen Schirm haltend, der sie beide abkapselt von der Welt. Oder: Schnee auf lauter um Schultern geschlungene Tücher. Die Millionenstadt Paris – in Franks Bildern besteht sie aus vielen intimen, aber nie zärtlichen, sondern oft matten oder angestrengten Situationen, bei denen die Kamera scheu dabei ist, so als habe der Fotograf den Kopf durch die Tür gestreckt, aber nicht gewagt, den Raum zu betreten. Sichtbar hat hier kein Formwille eine Bildkomposition aufgebaut, sondern die plötzlich wahrgenommene Situation ist in die Linse geschlüpft wie der Vogel in die hohle Hand. Oft sind die Konturen verwischt, kippen die Linien, immer sieht man das Korn des Kleinbildnegativs. Hier verbindet jemand, gerade Mitte zwanzig Jahre alt, meisterlich Flüchtigkeit, Lässigkeit mit der Treffsicherheit des genau richtigen Augenblicks: dem Kulminationspunkt einer Geschichte. So wie man später sagen wird, es sei der Blick des Europäers gewesen, der die Fotografien von »The Americans« so scharfsichtig und unerbittlich habe ausfallen lassen, so scheint es jetzt der schon entfremdete Blick des Europaflüchtlings zu sein, der in der Kapitale des alten Kontinents nichts als Erschöpfung entdeckt.
Robert Frank hatte bei einem Schüler des Schweizer Lichtbildners Hans Finsler gelernt, der als Ziel guter Fotografie eher den exakten Bildaufbau propagierte. Vermutlich hat Frank sich in seinen »impressionistischen« Paris-Fotos hiervon zu befreien versucht. (Gestärkt wird Franks Position von den Gegen-Bildern der gleichzeitigen Ausstellung von Otto Steinerts sorgsam konstruierten dito Bildern aus Paris.) Andererseits nehmen diese Bilder eine bewusste Gegenposition zur vorherrschenden Reportagefotografie von Life und anderen damals tonangebenden Magazinen ein, denn zwar will auch Frank Geschichten erzählen, aber keine fertigen. In der Tat scheinen alle Fotografien auf einen unmittelbar bevorstehenden Wechsel der Situation hinzudeuten, ohne dass man freilich zu sagen wüsste, was als nächstes passiert.
Insofern zeigt Frank Spuren, aus denen eine Geschichte, oder eine andere, oder eine dritte herauszulesen wäre. Spuren des Menschlichen allesamt, wie ein alleingelassener Blumenstand, ein vergessener Schirm, ein halb eingeklappter Stuhl auf einem Platz, ein einsam am Bordstein stehendes Fahrrad. Und zu allem immer dieser Abstand – nur ein-, zweimal blickt ein Augenpaar in die Kamera. Eins der Fotos zeigt einen alten Koffer, eine Decke, eine Karbid- oder Petroleum-Lampe sowie ein Schild, das das »Mysterium« der Chiromantie anpreist. Kein Mensch ist zu sehen. »The lines of my hand« heißt ein Fotoband von Robert Frank aus dem Jahre 1972 (als er nach jahrelangen Ausflügen in den Film wieder zu fotografieren begonnen hat) – es sind die Handlinien der Stadt, die Franks Parisbilder offenlegen, die weiche, verdeckte, aber heimlich alles prägende Innenseite menschlichen Lebens. //
Museum Folkwang (trotz des Neubaus geht der Betrieb im sog. Altbau weiter), bis 6. Juli 2008. Tel.: 0201/88-45301. Katalog bei Steidl, 30 € www.museum-folkwang.de.