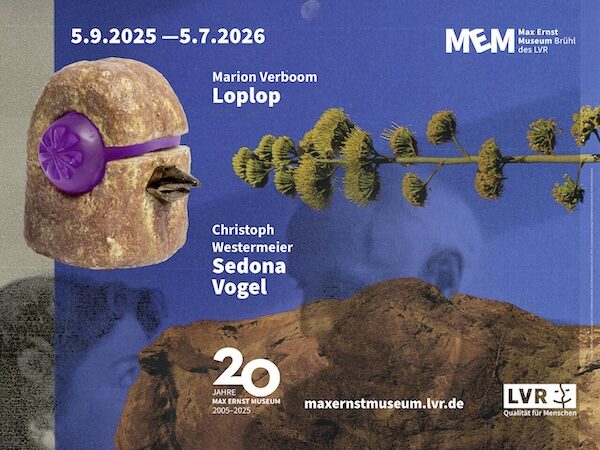// Einer der Defekte des Deutschseins ist, dass es ein verkrampftes Verhältnis zu sich selber pflegt. Mal geht die Eigenliebe »über alles«, mal sieht der Selbsthass schon im Mittelalter Auschwitz kommen. Zu den deutschen Defekten gehört allerdings auch, die Merkwürdigkeiten der eigenen Kultur als Defekte wahrzunehmen. Einfach deutsch sein scheint nicht möglich, war es übrigens schon vor Auschwitz nicht. Denn deutsch sein war immer eher Idee – Erlösung oder Fluch – denn selbstverständlicher Teil des Lebens. War. Ist? Der frühere französische Botschafter in der BRD, François Seydoux, konstatierte, die Deutschen befänden sich ständig in einer geradezu zwanghaften Sorge darüber, was Fremde über sie dächten. »Das Ablehnen der Fahne ist doch auch so ein Ausdruck des deutschen Negativen«, sagt mit stiller Fröhlichkeit eine Frau und erzählt, wie es einfach nur lustig war, während der Fußballweltmeisterschaft 2006 die schwarz-rot-goldene Flagge vor dem Haus hochzuziehen.
Beide Bemerkungen zum Deutschsein finden sich in der Bonner Ausstellung »Flagge zeigen? Die Deutschen und ihre Nationalsymbole«: das diplomatische Diktum aus den 1970ern im Katalog, das heutige unbeschwerte Ja zum hoheitlichen Hausschmuck als O-Film am Ende des Rundwegs im Haus der Geschichte. Der Parcours folgt der Historie, auf mit Fotos, Dokumenten, Objekten und Videos dicht bepackter Fährte von der Paulskirche bis zur WM. Was er erzählt, ist grosso modo eine Erfolgsgeschichte: Präludium in historischer Vorzeit, diverse Melodieversuche, endlich harmonisches Gelingen. Denn zwar folgt der Gang dem historischen Nacheinander, doch ist die Geschichte vom Ende her erzählt, vom
distanziert-gelassenen Verhältnis der Spätgeborenen zur nationalen Symbolik aus. So kommt es, dass breiter Aufenthalt in den Nachkriegsjahrzehnten der beiden deutschen Staaten bei ihren Versuchen geboten wird, zugleich die wahren deutschen und doch andere Symbole als der andere zu (er)finden. So kommt es, dass durch die langen, lodernden Zeiten, da man für eine Fahne zu sterben bereit war und der Anblick eines Hoheitszeichens den deutschen Körper zum Erschauern brachte, rasche Durchfahrt verordnet wird. Freiheitskriege, Hambacher Fest, Reichsgründung, Wilhelminismus, Weltanschauungskampf der Weimarer Zeit: wenig oder nichts. Und vor allem von der ungeheuren Fähigkeit des Nazistaats zur Symbolisierung von Macht, Zugehörigkeit, Herkunft, Erlösung – viel, viel zu wenig. Nämlich um verstehen zu können, warum zumindest in dem westlichen Nachfolgestaat das Symbolisieren des Staatlichen an sich bereits Angst und Ekel erregte.

Mit dem deutschen Model Claudia Schiffer wirbt die Standortinitiative »Deutschland – Land der Ideen« im Ausland.
© Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Michael Jensch, Axel Thünker
Wahrscheinlich hätte die Präsentation dieser anderthalb Jahrhunderte den Rahmen gesprengt; doch so wird zur Vorgeschichte, was die Hauptgeschichte des politisch Symbolischen ausmacht. Das ist schade. Allerdings: Der Katalog füllt die Lücke ganz. Man braucht ihn; mehr als die Exponate selbst. Hat man beides, bringt, diese anzusehen, reichen zeitgenössischen Geschmack auf die Zunge.
Wenn 1945 alles Deutsche besudelt ist, woran knüpft man dennoch an? An 1848. Zum gerade sich bietenden 100. Geburtstag klettert die SBZ nachholend mit auf die Märzrevolutionsbarrikaden, während die Westzonen das parlamentarische Prinzip der Paulskirchenepisode adoptieren (und das Gebäude rasch wiederaufgebaut wird). Doch über beiden Versuchen historischer Grundierung kommt kein sprechendes Bild zustande: 1948 ist 1848 längst vergessen, verdrängt. Prägnanter gerät die Bebilderung des öffentlichen (so nicht mehr öffentlichen) Raumes der DDR durch die ikonografisch typisierten Gesichter der kommunistischen Olympier. Gereckte Faust und Vereinigungshandschlag treten als neue Logos hinzu. Die Flagge ist Schwarz-Rot-Gold wie im Westen, denn die Einheit bleibt ja zunächst Ziel auch der ostdeutschen Regierung, »einig Vaterland« singt die von Johannes R. Becher und Hanns Eisler pünktlich 1949 komponierte Hymne. Als die Blöcke sich verfestigen, unterscheiden ab 1959 Hammer, Ährenkranz und Zirkel als Wappen die östliche von der westlichen Trikolore. 1950 lässt Ulbricht das Hohenzollernschloss in Berlin Mitte sprengen. 1980 stellt Honecker das Reiterstandbild Friedrich d. Gr. »Unter den Linden« wieder auf. 1990 verschwinden binnen Wochen sämtliche Exponate 40-jähriger Bemühung um deutsch-sozialistische Symbolik auf Flohmarkt und Schutthalde.
Der Bonner Provisoriums-Staats tastet anfangs viel unbeholfen-vorsichtiger nach dem symbolischen Ausdruck dessen, was man nach Hitler alles anders machen will. Man will auch politisch auf Kreppsohlen gehen. Also gibt es fast keinen Staatspomp, kaum Zeremonien. Aber keine deutliche Identifikation mit dem Widerstand des 20. Juli. Als Nationalfeiertag kommt der 8. Mai (1945) nicht in Frage und der 17. Juni (1953) wie gerufen: kein Tag des Stolzes, sondern des selbstgerechten Fingerzeigens. Man will eine andere Flagge: goldgerahmtes schwarzes Kreuz auf rotem Grund, so 1948 der Vorschlag der CDU. Der erste Bundespräsident Theodor Heuss stellt in seiner Silvesteransprache 1950 eine neue Nationalhymne vor, da der »ungeheure Geschichtseinschnitt mit dem alten Sinn- und Wortvorrat nicht mehr umfasst werden« könne. Doch der neue »Wortvorrat«, gedichtet von Rudolf Alexander Schröder, wirft nur einen Haufen Phrasen aus (»Land der Väter und der Er-ben…«). Halb verwirrt, halb bewältigungsunwillig bleibt man beim Alten, wozu neben der Hymne auch der Adler zählt. Mit dem Vogel (den die Nazis beibehielten) identifizieren sich in Umfragen mehr Westdeutsche als mit Schwarz-Rot-Gold (das die Nazis abschafften). Insgesamt bleibt die Freude an sämtlichen Nationalsymbolen praktisch bis zur Wiedervereinigung sehr verhalten. Für den mündigen Bürger gilt die Akzeptanz nationaler Symbolik beinah als pathologisches Symptom. Adenauers Mercedes ist ein stärkeres Sinnbild für das demokratische Deutschland als die Nationalflagge.
Woher kommt Schwarz-Rot-Gold? Die komplizierte Geschichte erzählt der Katalog, sie hätte sich auch in der Ausstellung gut gemacht, zumal diese ganz auf das gleichfarbige Fahnenmeer Partydeutschlands zuläuft. Es wäre doch schön, ganz deutlich zu machen, dass die heutige deutsche Trikolore zwar von den national-demo-kratischen Burschenschaftlern herrührt, aber kaum, wie oft erzählt, von den Haudegen der Lützow’schen Freikorps.
Das, was das neue, demokratische Deutschland im Kern ausmacht, das bleibt bis kurz vor der Wende symbolisch nicht oder nur schwach gefasst; überhöht wird es schon gar nicht. Ein Symbol in Bild und Wort wird Willy Brandts Kniefall in Warschau 1970, auch die Rede Richard von Weizsäckers zum 8. Mai 1985 stellt eine weitere zeichenhafte Stufe auf dem Weg in eine nationale deutsche Selbstverständlichkeit dar: Beide Akte wirken befreiend. Das Deutsche und seine Symbole verlieren an Dumpfheit.
In den 1980er Jahren beginnt man in der provisorischen Hauptstadt Bonn im großen Stil und für die Dauer zu bauen: neuer Plenarsaal, »Schürmann-Bau« für die Abgeordneten, Haus der Geschichte, Bundeskunsthalle. 1989 fällt die Mauer. Und mit ihr die Wachstumshemmung auf dem Feld nationaler Symbole: Wiederaneignung der alten Hauptstadt Berlin samt Reichtstagsgebäude (dessen Verhüllung durch Christo enthüllend wirkt), Holocaust-Denkmal, Schlossplatz-Debatte. Nur der 3. Oktober bleibt ein fader Feiertag. Noch in den 1970er Jahren war das Publikum regelmäßig verstummt, wenn bei Fußballnationalspielen die deutsche Hymne erklang. 2006 kleidet sich halb Deutschland in Schwarz-Rot-Gold. Die Deutschen lieben ihre Symbole wieder – weil sie keine Symbole mehr sind. Sondern Marken. Seit 2006 steht Deutschland auf dem »Nation Brands Index« auf Platz eins. //
Bis 13. April 2009. Tel.: 0228/9165-0. www.hdg.de. Katalog 19,90 €