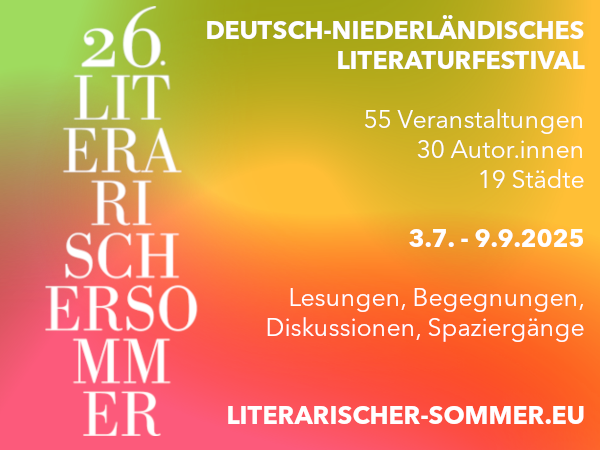Text Christiane Hoffmans
»Was ist das Paradies?«, fragt Stephan Mann. Er steht im hellen Ausstellungsraum des Museums Goch und blickt erwartungsvoll in die Gesichter von Jugendlichen. Rund 25 Schülerinnen und Schülern sitzen vor ihm auf dem Boden, locker im Schneidersitz. Eigentlich sollten sie auf die Gemälde schauen, die vor ihnen hängen. Doch anstatt sich mit dem »Paradis mystérieux« des französischen Künstlerduos M.S. Bastian und Isabelle L. zu beschäftigen, auf dem skurrile Geisterfigürchen auf dicken Ästen hocken und neugierige Schlangen durch die bunte Flora und Fauna tänzeln, blicken die Teenies überfordert auf die Muste-rung des Parketts. Mit Antworten wie »eine Villa« oder »ein Ferrari« will sich Mann nicht zufrieden geben. Keiner weiß, dass die Vorstellung vom Paradies eine Geschichte der Bibel ist. Also beginnt der Kunsthistoriker bei Adam und Eva.
Dass Stephan Mann Führungen mit Schulklassen selbst macht, ist keineswegs üblich in der Museumslandschaft. In den meisten Instituten gibt es eine Abteilung, die pädagogische Kurse und Führungen entwickelt für die gesellschaftlichen Gruppen: für Schüler, Studierende, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, Singles oder Familien. Doch das Museum Goch ist mit insgesamt drei wissenschaftlichen Mitarbeitern so klein, dass auch der Direktor hin und wieder zum museumspädagogischen Dienst eingeteilt wird.
Dass ein Museum in einer Kleinstadt wie Goch überhaupt in den Blick gerät, liegt an der aktuellen Debatte, die die Direktorin der Staatsgale-rie Stuttgart jüngst in der FAZ angestoßen hat. Christiane Lange fragte, ob es ein »dringendes Anliegen« sei, pro 50.000 Einwohner ein Museum zu haben?: »Wäre es nicht interessanter, dass es weniger, aber dafür qualitativ höherwertige Institutionen gibt?«. Ginge es nach ihr, müsste Goch mit seinen nur 35.000 Einwohnern das Museum im ehemaligen Amtsgericht sofort schließen.
In der Kunstszene wurde die Überlegung der Direktorin Lange mit Betroffenheit aufgenommen. Zum einen, weil die Forderung der schon vor gut zwei Jahren geführten Diskussion über das Buch »Kulturinfarkt« hinterherhinkt, in dem vier Autoren gegen »Auswüchse der Subventionskultur« zu Felde zogen. Zum anderen reagierten die Museumsszene, aber auch viele Politiker verständ-nislos, weil Lange die Qualität einer Institution an der Einwohnerzahl des Gemeinwesens, der diese angehört, festmacht.
Stephan Mann wollte eine solche These nicht unwidersprochen lassen und verfasste in der FAZ eine Erwiderung. Sein Hauptargument: die gesellschaftliche Relevanz eines Museums sei nicht abhängig von dessen Größe. »Hierarchiefalle«, überschrieb er seinen Text.
Was aber genau macht die Bedeutung eines kleinen Kunstmuseums in einem kleinen Ort in der Provinz aus? Stephan Mann geht nach der Führung in sein Büro. Vorher klärt er noch ein paar Dinge mit der Dame, die an der Kasse sitzt und gleichzeitig den Museums-Shop betreut. Um zu seinem Büro zu kommen, muss er durch das gemeinsame seiner Mitarbei-ter gehen. Es ist ein kleiner Raum, der Platz begrenzt. Luxus ist das nicht. Der Direktor muss den Raum zwar nicht mit anderen teilen, aber auch seiner ist nur auf Zweckmäßigkeit hin eingerichtet – von Repräsentation keine Spur.
In weitläufigen Büros zu residieren, wie es die Direktoren in großen Häusern machen, würde an einem Ort wie Goch überzogen wirken. Hier geht es darum, den Menschen direkt zu begegnen. Und da ist es auch nicht schlecht, wenn der Museumschef mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, wie viele Gocher. Um ein Museum in einer Stadt zu führen, die zudem noch rund eine Stunde Fahrzeit entfernt ist von größeren Städten wie Düsseldorf oder Nijmegen, muss man sich dessen Sinn und Zielrichtung genau überlegen. Im Grunde hat Stephan Mann daher seine Arbeit bei Adam und Eva begonnen.
»Ich habe schon sehr früh darüber nachgedacht, was Aufgabe dieses Museums hier sein kann«. Er sei dabei zu dem Schluss gekommen, sein Museum nicht über Besucherzahlen zu definieren. »Wir sollten nicht allein in ökonomischen Kategorien denken.« Sich nicht an Quoten zu orientieren, ist in unserer Gesellschaft, die den Wert einer Sache an deren Marktgängigkeit misst, ein Wagnis. Zudem stehen die meisten Museen aufgrund schwächelnder kommunaler Haushalte unter erheblichem finanziellen Druck. Da können Besucherzahlen ein wichtiges Argument für Politik und Sponsoren sein. Aber: »Bei einem Eintritt von vier Euro pro Person, wie viele Besucher müssen da kommen, bevor ein relevanter Betrag zusammenkommt?«, fragt Mann.
Er hat sich daher entschieden, ein Programm jenseits vermeintlicher Blockbuster-Ausstellungen mit Chagall oder Picasso zu gestalten. Als Stephan Mann vor 17 Jahren seine Arbeit aufgenommen hat, war das Museum Goch eine Art Stadtmuseum. Die Gemälde und Objekte wurden ins Depot gebracht, um Platz zu schaffen für die Kunst der Gegenwart. Felix Droese, Katharina Hinsberg, Gereon Krebber, Mbongeni Buthelezi oder Donatella Landi zeigten hier ihre Werke auf nicht gerade üppigen 1500 Quadratmetern. Gegenwartskunst ist immer ein Wagnis, da kann es schon mal vorkommen, dass nur 100 Besucher die Schau sehen. Für Mann ist das keine Katastrophe, denn sein Haus versteht er als Ort, an dem Menschen zusammenkommen und diskutieren. In einer kleinstädtischen Bürgerschaft gebe es ein großes Verlangen danach.
»Unsere Gesellschaft braucht einen Denk-Raum abseits der Parteien und Fitness-Center.« Ganz oben auf der Werteskala des Direktors steht die Vermittlung. Rund 5000 Schulkinder werden pro Jahr durch die Ausstellungen geführt. Das ist beeindruckend, verglichen mit der Staatsgalerie Stuttgart in einer Stadt mit rund 600.000 Einwohnern, die auf nur 12.000 kommt. Als Stephan Mann zu Anfang in Goch noch alle Führungen selber machte, wurde er auf der Straße von den Kindern gegrüßt. Seitdem ist der »Herr Museumsmann« eine feste Größe hier. Mit den örtlichen Unternehmen steht er in Kontakt. Empfänge und Diskussionsrunden sind unbedingt erwünscht.
Auch die Politiker tragen Manns Konzept. Dass Kunst und Kultur mitten in die Gesellschaft gehören, ist in Goch nicht nur ein Satz aus einer Sonntagsrede. Man lebt es. So hat der bisherige Bürgermeister, der bei der Stichwahl im September sein Amt abgeben musste, die Kultur direkt in der Verwaltungsspitze verortet – Stephan Mann stand ihm dabei zur Seite. Diese Konstruktion hat auch Auswirkungen auf die Umgangsweise mit den bislang über 600 Flüchtlingen. In Goch helfen nicht nur Sozialamt und Jugendamt, sondern auch die Kultur. Das Argument: Die Flüchtlinge müssten nicht nur sozial, sondern auch kulturell betreut werden. In der Stadtbücherei fungiert eine Mitarbeiterin als Nahtstelle zwischen Verwaltung und Freien Trägern.
»Wenn wir die Flüchtlinge untergebracht haben, fangen sie an, unsere Kultur kennenzulernen. Wo ginge das besser als im Museum?«, fragt Stephan Mann. Zudem seien Museen schon immer Vermittler zwischen den Kulturen gewesen. Schließlich zeigten auch Museen in kleinen Städten ständig internationale Kunst, und viele ausländische Künstler kämen in die Häuser. Das ist in Goch nicht anders. Diese Kompetenz müsse jetzt stärker genutzt werden. Stephan Mann weiß, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen es vernachlässigt haben, zu begründen, weshalb sie ein Museum führen. »Wir haben zu lange geglaubt, der Geldsegen fließt automatisch, aber diese Zeiten sind vorbei.« Paradiesische Zustände gibt es nur noch auf der Leinwand. Aber davon ist Stephan Mann fest überzeugt: »Gerade in kleinen Museen findet eine Arbeit statt, die von größeren Museen in den Metropolen – auch auf-grund der Anonymität der Großstadt – so gar nicht geleistet werden kann.«