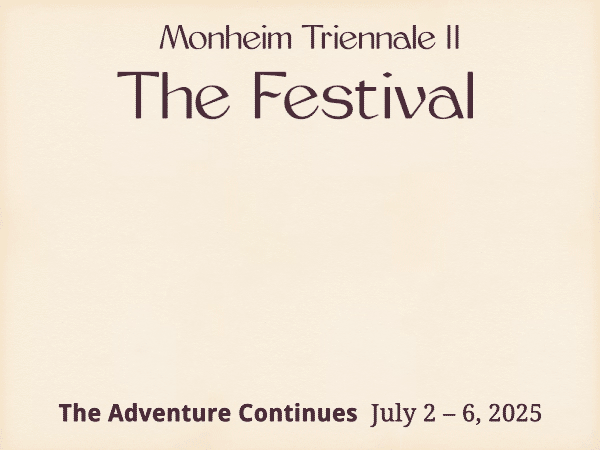INTERVIEW: ULRICH DEUTER
K.WEST: Die Ruhrfestspiele haben es heuer mit Schiller, zwei Jahre nach dem letzten Schillerjubiläum. Sie selbst hatten es auch zumindest schon einmal mit Schiller, in Ihrem Stück »Schwarze Minuten«, das dessen Erzählung »Der Verbrecher aus verlorener Ehre« paraphrasiert. Ohne zu viel zu verraten, kann man sagen, dass auch Ihr neuestes Stück »Aufstand«, das Frank Hoffmann in Recklinghausen herausbringt, mit Schiller zu tun hat: Das Personal erinnert mächtig an das der »Räuber«. Was dabei hat noch mit Schiller zu tun?
OSTERMAIER: Schiller ist sicher einer der Echoräume des Stückes. Der junge Schiller, der politische, der sich selbst als Schriftsteller erfindende, der gegen die Wirklichkeit mit dem Kopf anrennt wie gegen eine Wand. Gegen die Wände, die ihm alle Freiräume nehmen, gegen die Inhaftierung in eine fremdbestimmte, begrenzte Persönlichkeit, die von ihm entworfen wurde, und gegen die er, um sich selbst wirklich werden zu lassen, rebellieren muss. Die Selbstkonstituierung als Schriftsteller ist bei Schiller ein politischer Akt. Er hat sein Schreiben immer den Umständen und der Krankheit abgerungen, es ist ein permanenter Ausnahmezustand, ein Zwischen-den-Zeilen-Krieg gegen seinen Körper und die Körperschaften des Staates. Die Hauptfiguren in »Aufstand« verbinden genau diese Motive und Motivationen mit Schiller. Außerdem ist das Stück in einem dauernden, unsichtbaren Dialog mit ihm und seinen Texten. Aber die muss man nicht kennen oder entdecken, um das Stück verstehen zu können.
K.WEST: Es gibt noch einen Text, dessen Echo durch Ihren »Aufstand« geht, eine aus 2007 stammende anonyme Internet-Flugschrift mit dem Titel »Der kommende Aufstand«. Darin werden die Gesellschaften des Westens als völlig an ihr Ende gelangt beschrieben, es wird die Krise beschworen und der Untergang gefeiert, aus dem dann eine neue Ordnung – eine Art Assoziation von Kommunen – hervorgehen soll. Ihr Stück legt Passagen aus dieser anarchistischen Flugschrift den »Unsichtbaren« in den Mund: Charles und seinen Genossen, die so etwas wie eine Stadtguerilla sind. Was gefällt Ihnen an »Der kommende Aufstand«?
OSTERMAIER: Stadtguerilla erinnert mich zu sehr an die RAF. Zwar wird auch in diesem Manifest der bewaffnete Aufstand thematisiert, aber nicht propagiert. Was mich fasziniert ist, dass es eine ebenso radikale, schonungslose Analyse unsere Gegenwart in der Gesellschaft und in den Köpfen und Herzen ist, aber zugleich auch ein Gedicht, von unerwarteter sprachlicher Schönheit und Präzision. Vergleicht man das Manifest mit den Textungeheuern der RAF, wird klar, dass Sprache ein politisches Instrument ist.
K.WEST: Ihr Stück bezieht sich also auf zwei Texte, die jeweils die Hälfte der Zuschauer nicht kennt. Die Jungen kennen die »Räuber« nicht. Die Älteren nicht »Der kommende Aufstand«. Kalkül oder notgedrungene Inkaufnahme?
OSTERMAIER: Das Stück muss ohne jegliche Vorkenntnis funktionieren und verstehbar sein. Es wird beim Kartenverkauf keine Testfragen geben. Das Stück hat sicherlich einige Anspielebenen, die sich nur aus diesen beiden Texten, sondern auch aus Filmen speisen, aber das darf keine Rolle bei der Rezeption spielen. Vielmehr erklärt sich das Stück im Spiel selbst und zeigt, wie so ein Manifest entstehen konnte. Wer nichts kennt, aber offene Sinne und Neugierde mitbringt, wird mehr von dem Abend haben, als der, der alles zu kennen glaubt, aber verschlossen bleibt. Es ist unsere Aufgabe, nicht Hemmschwellen, sondern Treppen zu bauen.
K.WEST: Den Terroristen mit ihren coolen Decknamen (Charles, Carlos, April, Trotzki, Mirror) stehen zwei Fahnder gegenüber, die Eduard und Gudrun heißen müssen; beide Gruppen verstecken sich im selben Gebäude, dem Alten Rathaus – sie agieren also im selben gesellschaftlichen Raum. Außerdem sind die Grenzen zwischen der Guerilla und der Polizei – sagen wir mal: fließend. Als Analyse der Gesellschaft ist das aber politisch sehr inkorrekt.
OSTERMAIER: Literatur ist nicht korrekt, darf nicht korrekt sein, Poesie entsteht aus Regelverletzung, Überschreitung, Verrücken des als unverrückbar Geglaubten. Poesie ist Perspektivenwechsel, Drama Blickwechsel. Und dass in jedem Gejagten auch ein Jäger und jedem Jäger auch ein Gejagter stecken kann, dass die Verwischung, also die Unschärfe die eigentliche Scharfstellung ist, dass wissen wir doch aus jedem gelungenen Kriminalfilm. Jeder Profiler denkt sich parasitär in den Kopf dessen ein, den er sucht und nur finden kann, wenn er ihn auch in sich findet. Und wie gesagt, die Anarchisten in meinem Stück sind keine Terroristen, sondern sollen zu solchen gemacht werden, weil es politisch opportun ist.
K.WEST: Den härtesten und fiesesten der – sagen wir also: Aufständischen, Deckname Trotzki, spielt in Recklinghausen der Münchner Tatort-Kommissar Franz Leitmayr alias Udo Wachtveitl. Sie stammen auch aus München, deshalb unterstelle ich, dass Sie sich Wachtveitl gewünscht haben, um Rache an der anständigen Münchner Gesellschaft zu üben.
OSTERMAIER: Da kennen Sie aber München schlecht, wenn Sie glauben, die Münchner Gesellschaft wäre anständig! München war schon immer eine im schlechten wie im guten Sinne unanständige Stadt. Die erste Räterepublik auf deutschem Boden war in München, das erste demokratische Gebilde des neuzeitlichen Europa war in Bayern, 1705, das Braunauer Parlament, als Folge des Bauernaufstandes. Den Bayern wohnt immer der Widerspruch inne gegen den Staat, die Obrigkeit. Anständig sind hier nur die Düsseldorfer. Und ja, Udo Wachtveitl ist eine Wunschbesetzung, ein guter Freund und ein sensationeller Schauspieler, der viel zu schade dafür ist, mit ihm nur Rache zu suchen. Das würde sich rächen. Und das Stück hat nun auch nichts mit München oder Bayern zu tun.
K.WEST: Die Methode des Polizisten oder »Verfolgers« Eduard ist es, Verbrecher mittels Büchern zu fangen. Er denkt, mit Proust z.B. könnte ich ihm auf die Spur kommen. Wie das funktioniert, ist schwer zu verstehen, erinnert aber daran, wie Schriftsteller arbeiten: Sie fahnden nach der Wirklichkeit mit den Mitteln der Fiktion, der Literatur. Existiert also eine Affinität zwischen dem poetischen Schreiben und der Kriminalistik?
OSTERMAIER: Was ist Schreiben anderes als Spurensuchen, falsche Fährten legen, Fingerabdrücke zu hinterlassen und sie freizulegen. Dort zu suchen, wo niemand sucht, dort zu finden, wo niemand findet. Schriftsteller bewegen sich manchmal in ihren Texten, Hirnen und poetischen Landschaften wie diese Menschen in den weißen Overalls der Kriminaltechnik. Es geht um Profile, Psychologie, Paranoia. Das Verhör ist ein Drama. Schriftsteller oszillieren zwischen Täter und Opfer, entdecken jeweils im einen Spuren des anderen. Nur: Schriftsteller haben kein Alibi. Am Ende sind es immer sie gewesen.
K.WEST: In Ihren Stücken spielen Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen oder sich gegen diese stellen, öfter mal eine große Rolle. Noch allgemeiner gesagt: Es geht fast immer um Tod, Gewalt und nicht zuletzt um Feuer. Was würden Sie gern in Brand stecken?
OSTERMAIER: Ich würde gerne die Phantasie befeuern, ermutigen, dass man das, was einem unter den Nägel brennt, ausspricht. Ich finde es gut, wenn man für etwas brennt, eine Leidenschaft hat, sich angreifbar macht, weil man für etwas steht. Und wofür man steht, dass beweist sich angesichts des Extremzustands, der Bedrohung. Ich bin kein Brandstifter, wäre wesentlich lieber ein Sinnstifter. Ich verabscheue jede Form von Gewalt. Und besonders jene unsichtbare, schleichende, die wir zu gerne übersehen, weil wir sie nie sehen wollen.
K.WEST: Die »Unsichtbaren« und ihre Verfolger haben sich gegenseitig eingekesselt. Es sind Waffen im Spiel. Aber alle denken die halbe Zeit an eines: Sex. Können Sie sich das erklären?
OSTERMAIER: An was denken Sie die halbe Zeit? Die Gruppe veranstaltet keinen Gruppensex, aber Sex und Politik gehören zusammen, sie sind Triebfedern. Das ist schon bei Shakespeare so, wenn das Private politisch und das Politische privat wird. Gerade in der Liebe und im Sex lässt sich über Macht und Manipulation erzählen. Außerdem heißt es doch, dass Sex, Crime and Violence der Schlüssel zum Erfolg sind, oder?
K.WEST: Sie sind jüngst Leiter des Romantik-Festivals der Gräfin von Oeynhausen in Bad Driburg geworden. Kommt jetzt das Ende der wilden Ostermaier-Jahre und künftig nur noch Sanftes und Elegisches aus Ihrer Feder?
OSTERMAIER: Ich glaube, Sie haben ein völlig falsches Bild der Romantik. Und genau, weil Sie da nicht der einzige sind, der bei Romantik an romantisch denkt, braucht es dieses Festival. »Indem ich dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es«, definiert Novalis die Romantik. Sie war eine der innovativsten Zeiten der deutschen Kultur: So viel Anfang war nie. Und was brauchen wir im Angesicht der Krisen mehr, als einen Anfang? Was für eine treffendere Zielsetzung könnte es für ein neues Festival geben? Und zum zweiten Teil Ihrer Frage: Ich weiß gar nicht, ob ich wilde Jahre hinter mir habe. Und wenn ich plötzlich über Bäume schreiben sollte, dann wohl eher im Sinne Brechts, wenn ein Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist. Ich glaube auch eher, dass ich wieder politischer werde, statt, auch wenn’s schön ist und mitunter gut tut, sanft und elegisch. Mein nächstes Stück geht über Franz-Josef Strauß.
»Aufstand«, Uraufführung am 10. Mai 2011 im Rathaussaal Recklinghausen. Weitere Termine 11., 12., 13., 14., 15. Mai. Tel.: 02361/9218-0; www.ruhrfestspiele.de