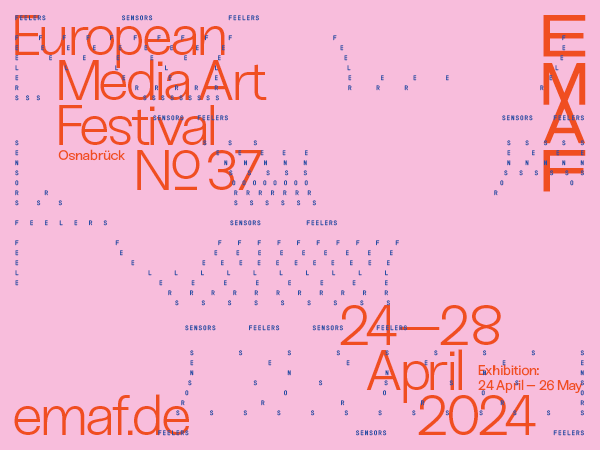TEXT: ANDREAS WILINK
»Warum also heute ein Sittenstück aufführen. Warum in die Mottenkiste greifen. Die Unzulänglichkeit der Gattung wurde vorgeführt. Warum also… Grob könnte man sagen, dass ein historischer Umbruch, dem Goldonis Stück vorausgeht, heute ansteht.« So Einar Schleef im Vorwort zu seiner Extremfassung der »Trilogie der schönen Ferienzeit«, die er 1999 im Burgtheater opulent als »Wilder Sommer« herausbrachte. In der 1761 verfassten Typenkomödie des Venezianers warten die Seelenkasper schon darauf, Charakter zeigen zu dürfen. Der Absolutist Schleef forderte die akute Zustandsbeschreibung, egal ob in Rokoko-Reifröcken oder Versace-Dessous. Es geht ums Ganze: um Geld- und Geschlechtsverkehr. Man muss hoch springen. Oft kommt das Theater dabei nur auf halbe Höhe. Auch am Düsseldorfer Schauspielhaus.
Eine Palme biegt sich über einem Strandidyll: ein Videobild. Daneben hängt ein Gemälde, das das gleiche Ferienkatalog-Motiv aufnimmt. Die Differenz zwischen Sein und Schein ist so groß oder gering wie die zwischen der fotografischen Aufnahme und ihrer malerischen Nachahmung. Das ist der Trick des Stücks und bleibt ein Problem seiner Aufführung, die sich in einer modisch aufgepeppten, aber unkonkreten, bunt gemalten Grauzone einrichtet.
Zwischen planer Abbildung und verschärfter Übertragung versucht Wolfgang Engel die Oberfläche zu durchdringen, indem seine Inszenierung rein an eben dieser bleibt. Die Flachsicht bedient sich des ästhetischen Formats eines Helmut-Dietl-Films. Engel führt vor, wie billig teurer Ramsch ist, auch mittels der Kostüme (Zwinki Jeannée), die mit Seide und Halbseide eine Show abziehen.
Die vier Stunden sind sauber gearbeitet. Doch bringt Engel das Ensemble nicht über ein Mittelmaß, das es vor zwei Jahren weit überstieg, als er Thomas Manns biblischen Roman »Joseph und seine Brüder« zum wundersam beiläufigen Gottesspiel machte. Lief es dort auf Heilwerdung einer Welt der Frühe hinaus, steht Goldoni fürs Gegenteil: Etwas zerbricht. Doch will man das Verharren im Konventionellen und Klischeebesetzten nach der feinen Konzentriertheit des »Joseph« kaum wahrhaben.
Auf der großen Bühne des Central häuft sich Trödel, der sich durch Spiegelwände noch vermehrt. Ruckzuck, forciert auf Tempo gebracht mit Rossini und etlichen Canzoni, die in ihrem Schmelz geschleift werden, geraten wir in den Reisestress eines Bürgertums, das mit Familie, Freunden, Schnorrern, Mitgiftjägern von Livorno in die Sommerfrische Montenero aufbricht. Da wurde noch fix ein Modellkleid Marke Mariage in Auftrag gegeben, müssten Rechnungen beglichen, wollen galante Verabredungen getroffen werden. Nach dem Aufbruch breiten die Bediensteten große Tücher übers Mobiliar, und mit einem Dreh lümmelt sich die Bagage am Lido unterm Sonnenschirm: blasse Buben, graues Männermittelalter und farbenfrohe Damen.
Filippos Tochter Giacinta (Katrin Röver) nutzt das Privileg weiblicher Raffinesse. Fast eine Minna von hellem Verstand, hat sie die Wahl zwischen zwei Bewerbern. Der eifersüchtige Leonardo, den Michele Cuciuffo mit Zorro-Manieren akustisch wie gestisch breittritt, trägt ihr die Ehe an, auch um seinen desolaten Haushalt zu sanieren. Guglielmo schneidet besser ab, kriegt aber schließlich nur Vittoria, Leonardos Schwester. Die Strategien für den pursuit of happiness gehen nicht auf. Die Mechanik der Anpassung an die Konvention greift – und quält vor allem Giacinta, die am Ende des zweiten Teils, als andere schon wieder nach Livorno eilen, im Regen steht. Zuletzt haben sich vier Paare verkehrt zusammen getan und die Schauspieler uns – frontal zugewandt – hübsch aufgeklärt über etwas, das allen längst klar gewesen ist.