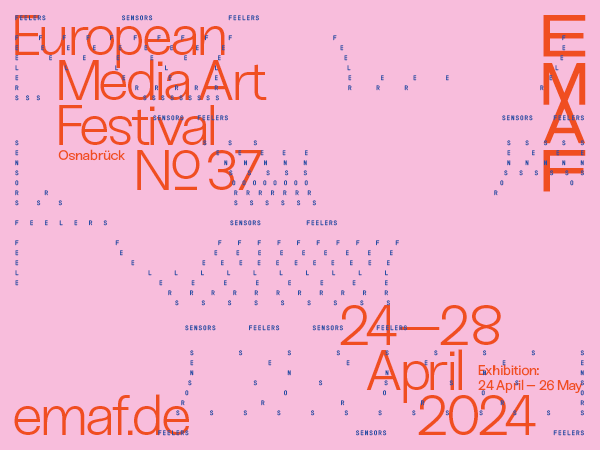TEXT: ANDREAS WILINK
Es gibt ein eigenartiges Phänomen am deutschen Stadttheater: den Schauspieler, den es nicht bei seinen Leisten hält. Er will Regisseur sein. Oft sind es die besten, sensiblen, gefährlich individuellen Darsteller, die Position und Standpunkt wechseln: Hans-Michael Rehberg, Burkhart Klaußner, Ernst Stötzner, Thomas Dannemann, Herbert Fritsch, der im kommenden Mai sogar mit zwei eigenen Inszenierungen (aus Oberhausen und Schwerin) zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Der Auszeichnung zum Trotz, als Regisseure sind sie durch die Bank nur halb so gut, wie als Schauspieler, wo sie oft wechselseitig prägende und befruchtende Erfahrungen mit Regie-Alphatieren wie Zadek, Giesing, Bondy, Gosch oder Castorf gemacht haben. Als Regisseure nicht unbedingt unentbehrlich, hinterlassen sie als Schauspieler eine Leerstelle.
Der gebürtige Dortmunder Peter Jordan, der am Schauspielhaus Bochum, am Hamburger Thalia Theater, am Berliner Gorki-Theater und bei den Salzburger Festspielen im Engagement war und wesentlich mit Dimiter Gotscheff und Jürgen Kruse gearbeitet hat, debütierte in seiner Geburtsstadt als Regisseur mit Shakespeares »Macbeth«. Man rätselt, wie jemand, der seit Jahr und Tag in der A-Klasse Theater macht und mitbekommt, solch einen Unfug veranstalten kann.
Hohles Aufsagetheater, am Rande stehen gelassene Figuren, abgegriffene Mittel, stupides Vokabular: hier ein Totentanz mit Küsschen, dort irres Hohngelächter, plakativer Blutanstrich, erotisches Gegrabsche, aus dem Timing geratene Schwertkämpfe (choreografiert vom unvermeidlichen Klaus Figge). Unoriginell bis in die geschichtspessimistische These, dass im großen Schlachthaus Welt ein König wie der andere ist, die Krone am Ende niemand will und sie wie ein unliebsames Requisit schließlich Banquos Kind zufällt. Geschenkt!
Zwei Stunden lang wird nahezu ununterbrochen gebrüllt, vermutlich, um der Gewalt Ausdruck zu verleihen, die Heiner Müllers Übertragung inne wohnt, deren fleischesrohem Text förmlich die Haut abgezogen ist. Ein nervender Moritatensänger (Rocker mit Gitarre) setzt den Rahmen, breitbeinig gespreizte Lederkerle werfen große Schatten, die Hexen-Luder girren geil, die Lady stolziert wie eine Opernball-Debütantin – Puccini auf den Lippen – in den Wahn. Björn Gabriel als Thronräuber wäre, wenn er gekonnt und gedurft hätte, als narzisstischer Beau (Schwachheit, dein Name ist Bube) vielleicht ein interessanter Charakter geworden. Stattdessen spielt auch er die Schreihals-Nummer. Abgesehen von der trichterförmig Helligkeit und Heil aufsaugenden Bühne (Daniel Roskamp), auf der die Klamotten zahlloser Todesoper als Trophäen wie in der Waschkaue unter der Decke hängen, gab es nichts zu sehen. Reine Zeitverschwendung.