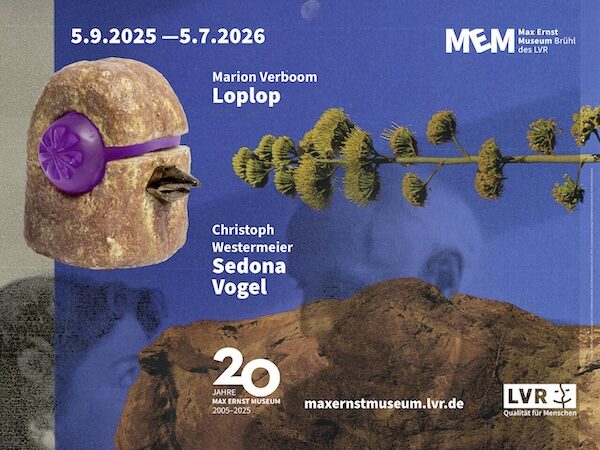Es ist die berühmteste und zugleich simpelste Klanginitiale der Musikgeschichte. Das zweimal wiederholte »G« und der doppelt so lang erklingende Unterterz-Ton »Es« bilden das Eröffnungsmotiv von Beethovens 5. Sinfonie. Als das Pochen »des Schicksals an die Pforte« hat einst der Beethoven-Schüler Anton Schindler dieses »Ta-ta-ta-taaaa« zu hören geglaubt. Womit der Beiname für eine Sinfonie geboren wurde, der bis heute in keinen Musiklexika und Konzertprogrammheft fehlen darf: »Schicksalssinfonie«. Beethovens Fünfte, dieses epochale wie bei Orchestern und Publikum so beliebte Werk, steht denn auch beim diesjährigen Bonner Beethovenfest quasi als Klangleitfaden gleich vier Mal auf dem Programm.
Mal klassisch auf modernen Instrumenten gespielt, mal klang-historisch mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment sowie sogar in einer Fassung für zwei Klaviere zu acht Händen. Unter dem Motto »Schicksal« steht der inzwischen vierte von der künstlerischen Leiterin Nike Wagner verantwortete Bonner Konzertreigen. Und da die Kulturwissenschaftlerin bereits bei ihrem Debüt-Festvortrag 2014 herausstellte, dass sie beim Beethovenfest »mit konzeptuell und dramaturgisch geschärften Programmen in den Dialog mit dem Werk dieses überwältigend kreativen und überwältigend geschichtsträchtigen Komponisten« treten wolle, taucht das Grundmotiv des Schicksalhaften, des von Krankheit, Krieg und Trauer ausgelösten Leids in zahllosen Variationen auf.
Kölns GMD François-Xavier Roth stemmt konzertant mit seinem Originalklang-Ensemble Les Siècles mit Hector Berlioz’ »La Damnation de Faust« nicht nur eines der spektakulärsten Vokalwerke des 19. Jahrhunderts. In diesem opernhaften Opus Magnum wird sogar vom betrunkenen Brandner das »Schicksal einer Ratte« besungen. In beklemmend düsteren Farben erklingt dagegen das bewegende »Quartett für das Ende der Zeit«, das Berlioz´ Landsmann Olivier Messiaen 1941 während seiner Internierung in einem deutschen Kriegsgefangenenlager komponiert hat. Und als eine »Musik der Trauer« angesichts der Gräuel und der Opfer des Nationalsozialismus schrieb Karl Amadeus Hartmann sein »Concerto funebre«; das jetzt von der moldauischen Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja mit weiteren instrumentalen Abschiedsgesängen, unter anderem vom Schweizer Frank Martin und dem amerikanischen Jazz-Avantgardisten John Zorn, kombiniert wird.
»Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem.« (Wolfgang Herrndorf)
Eine besonders spannungsvolle Gegenüberstellung aufwühlender Klang- und Schicksalswelten erwartet einen aber unter dem Titel »Letzte Worte«. Vom Hamburger Ensemble Resonanz konzipiert, wechseln sich hier die einzelnen Sätze von Joseph Haydns Passionsmusik »Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze« mit Ausschnitten aus Wolfgang Herrndorfs Tagebuch »Arbeit und Struktur« ab. Im Mittelpunkt des musik-literarischen Dialogs steht Birgit Minichmayr. Eine Frau? Auch die Schauspielerin selbst war verblüfft, als man sie für das Projekt anfragte. »Das sind ja Tagebuchnotizen, und Herrndorf hat sie natürlich in Ich-Form geschrieben«, so Minichmayr. »Aber dann ging es gerade darum, dass es nicht die totale Identifikation sein sollte, sondern um eine gewisse Distanz, die sich schon über die weibliche Stimme herstellt.« 2010 und damit in jenem Jahr, als sein Erfolgsroman »Tschick« erschienen war, hatte Wolfgang Herrndorf erfahren, dass er an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankt war. Die nächsten knapp drei Jahre, bis zu seinem Freitod im August 2013, dokumentierte der Schriftsteller sein Leben und Leiden in einem Blog. Auch die nach seinem Tod als Buch erschienenen Aufzeichnungen (»Arbeit und Struktur«) lesen sich wie das Abschiedsprotokoll eines Atheisten, der doch flehte: »Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem.«
Zu einem unerwarteten Abschiedsgruß wird nun hingegen der Konzerttermin mit dem Sinfonieorchester Flandern unter der Leitung von Jan Latham-Koenig. Denn Dieter Schnebel, Komponist des nun uraufgeführten Auftragswerks »(BSH) Schicksalslied. Beethoven – Hölderlin«, war im Mai im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war nicht nur der letzte große Vertreter einer Komponistengeneration, zu der Stockhausen, Boulez sowie Kagel gehörten. Der studierte Theologe war ein musikalischer Freigeist, der sich von allen Neue-Musik-Schulen heraushielt. Mit seinen »Maulwerken«, bei denen die menschlichen Artikulationsorgane außer Rand und Band geraten, trat Schnebel sogar in der Unterhaltungsshow »Bio’s Bahnhof« auf. Bei den Donaueschinger Musiktagen präsentierte er seine rund 150-minütige »Sinfonie X«, mit der er die Gattung hinterfragte. Und dass er selbst im reifen Alter von 70 Jahren einen Hang zum Absurden besaß, bewies Schnebel im Jahr 2000 mit der musikalischen Aktion »Harley-Davidson«, bei der neun Biker entsprechend der Gesten eines Dirigenten ihre Maschinen aufheulen ließen.
Dass der gebürtige Schwarzwälder zudem ein erfrischend anderes Verhältnis zu Beethoven besaß, hat er auch in seinem Orchester-Zyklus »Re-Visionen« dokumentiert. Schließlich gibt es neben all den Reflexionen der Werke etwa von Bach, Wagner und Webern da ja auch eine Neubelichtung der Schicksalssinfonie – völlig entschlackt von jeglichem Schicksalspathos.
bis 23. September, www.beethovenfest.de