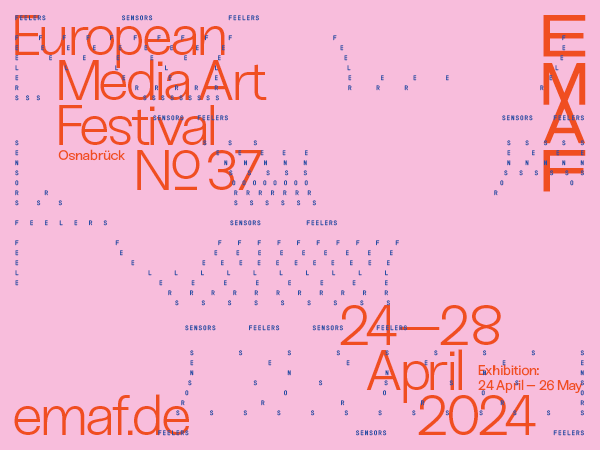»WARNUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 15 Jahren. Die Aufführung enthält anstößige Dialoge, Nacktszenen und Gewaltdarstellungen.« Natürlich ist dieser Hinweis der Sydney Theatre Company den restriktiven Jugendschutz-Bestimmungen in Australien geschuldet. Aber für Barrie Kosky, den Autor, Regisseur, Musikchef und Pianisten der Produktion »The Lost Echo«, die im vergangenen September in Sydney Furore machte, ist diese Warnung irgendwie auch ein Markenzeichen. »There’s just not enough troubelmakers there«, diagnostizierte Kosky einmal aus dem fernen Europa über seine Heimat Australien, wo er 1967 geboren wurde. Und weil die Störenfriede am besten aus dem eigenen Lager kommen, übernahm der Mann aus Melbourne selbst die Aufgabe des Troublemaker und wirbelte die heimische Theaterszene in den 90er Jahren kräftig auf.
Mit der Gilgul Theatre Company, die er mit 23 Jahren gründete, suchte Kosky die Tradition des jüdischen Theaters und Geschichtenerzählens zu erneuern. 1993 brachte er am Opernhaus von Sydney Larry Sitskys Musiktheater »The Golem« mit Anspielungen an die Deportation der Juden auf die Bühne, was die sonst eher gelassenen Australier ebenso aufbrachte wie die fluoreszierende Riesenratte im Bühnenbild von »Nabucco« oder die sexualneurotischen Exzesse in seiner Produktion von Shakespeares »King Lear«. Koskys Spezialität ist das seziererische Aufbrechen eines Werks und seine Spiegelung in anderen Epochen. Monteverdis »Krönung der Poppea« hat er mit Musik von Cole Porter versetzt; sein jüngstes Theaterprojekt »The Lost Echo«, eine achtstündige theatralische Phantasie über Ovids »Metamorphosen«, bündelte seine Visionen im Mythos von Orpheus und anderen »Urkünstlern« auf ganz unterschiedlichen Stilebenen. Systematisch und furchtlos bastelte der Aufrührer so am Ruf eines australischen enfant terrible, der ihm bis heute anhängt – auch wenn er mit nunmehr 39 Jahren das Kind in den Orkus seiner bewegten Vergangenheit gestoßen hat.
Terrible aber will Barrie Kosky immer noch sein. Zwar nicht im Gespräch auf den Lederpolstern im Essener Opernfoyer, wo er vergnüglich aus seinem Erfahrungsschatz plaudert und dazu mit seinen imposanten Fingerringen klimpert. Aber doch auf der Bühne, die für ihn kein Ort zum Zurücklehnen ist. »Ich finde es dekadent und faul, ein Stück zu machen, für das man keine Besessenheit empfindet«, erklärt Kosky in fließendem, manchmal phantasievoll bereichertem Deutsch. »Man muss sich vorher darüber klar sein, ob man zwei Jahre über ein Werk nachdenken und mit demselben Stück dann acht Wochen in einem Probenraum sein will. Das ist eine wichtige Entscheidung für den Regisseur. In deutschen Theatern stelle ich mir manchmal die Frage, ob die Regie eine persönliche Rache am Stück nimmt – oder schlimmer, ob vielleicht gar nichts dahinter steckt. Dann muss man keine Oper machen.« Erstaunlich, dass gerade ein wenig zimperlicher Theatermann wie Kosky sich derart wertkonservativ äußert. Gleichwohl hegt er keine Abneigung gegen die interpretierende Regie im Allgemeinen, nur gegen die Vergötterung des Regisseurs. »Das Label ›Regietheater‹ ist schon das Problem: Die Idee, dass es einen Regisseur gibt, dem alle untergeordnet sind. Das ist falsch. Die typisch deutsche Auffassung vom Regisseur als Patriarch und Oberpuppenspieler richtet sich gegen Herz und Seele des Theaters. Wir machen Oper, weil wir immer Utopia suchen. Die perfekte Beziehung zwischen Regisseur, Dirigent und Darstellern. Das ist Utopia!«
»Amen«, scheint es, jault dazu der sauber gescheitelte Cocker-Spaniel, der Kosky stets begleitet, Maskottchen und guter Freund in einem. Vermutlich hat er mitgejault, als das Essener Publikum Koskys erste Regiearbeit am Aalto-Theater, Richard Wagners »Fliegenden Holländer«, gnadenlos niederbuhte. Unmut erregte zumal der Chor der Geisterbesatzung des Holländer-Schiffs, der Kosky zu einem wilden Albtraum, gefüllt mit nekrophilen Perversitäten, inspirierte. Die Zuschauer nahmen die Szene mit ihren grotesken Jahrmarktselementen wörtlicher als sie gedacht war und überschütteten Regisseur und Intendanten mit Kritik – was Stefan Soltesz nicht hinderte, Kosky gleich wieder zu verpflichten. Recht hat er, denn die handwerkliche Brillanz der »Holländer«-Inszenierung, ihre unheilvolle Dynamik und der Höchsteinsatz des Ensembles versprechen auch für weiterhin aufregende Einblicke. Vorausgesetzt, man lässt Kosky so arbeiten wie in Essen oder an der Komischen Oper Berlin, wo er mit Ligetis »Grand Macabre« und Mozarts »Figaro« die Meinungen spaltete. »Ich habe in Berlin und in Essen wirklich alles, was ich brauche: ein wunderbares Ensemble und mit Homoki und Soltesz Intendanten, die Theatermenschen sind und Risiken eingehen. Eine ideale Kreativstimmung, um zu arbeiten.«
Wieder steht in Essen mit »Tristan und Isolde« Wagner auf dem Programm. Barrie Kosky – auf dem Weg nach Bayreuth? »Um Gottes Willen! Schlimm genug, dass es meine dritte Wagner-Oper in zwölf Monaten ist. Das war nicht geplant. Es war ein Fehler, ›Lohengrin‹ im letzten Jahr an der Wiener Staatsoper zu inszenieren. Obwohl das Werk nie im Pantheon meiner Lieblingsopern war, hatte ich zugesagt. Eine interessante Erfahrung, aber eine, die ich nie wiederholen möchte. Ich hatte Probleme mit dem Dirigenten, dem Intendanten, den meisten Sängern und vor allem mit dem Stück selbst. Denn im Grunde finde ich Lohengrin als Figur entsetzlich. Ich hasse ihn!«
So wurde dieser »Lohengrin« ein Abschied von Wien mit Pauken und Trompeten – von der Stadt, in der Kosky fünf Jahre lang das Schauspielhaus in der Porzellangasse als Kodirektor geleitet hatte. Dabei war Wien für ihn von Jugend auf ein Bezugspunkt. Koskys Großeltern stammen aus Ungarn, Polen und Russland. Schon in seiner Jugend in Melbourne hat ihn die europäisch-jüdische Herkunft stark beschäftigt. Und während die »Aussies« auf dem fünften Kontinent damit zu tun hatten, ihre eigene Identität zu feiern, suchte Kosky nach seinen eigentlichen Wurzeln. Er fand sie peu à peu: in einem Buch mit Fotos von Leichenbergen und verhungerten Menschen aus deutschen Konzentrationslagern, bei der Arbeit mit dem Gilgul-Theater, später auf den Straßen Wiens.
»In Österreich ist der Antisemitismus immer noch viel schlimmer als in Deutschland. Hier hat man seit den 70er Jahren einen Prozess der Aufarbeitung hinter sich – was mich immer wieder überrascht und was auch wunderbar ist. Nur auf der Bühne bekommt man hier selten andere Aspekte von jüdischer Kultur zu sehen als den Holocaust. Selbst die Juden in Deutschland und Österreich sind so besessen vom Nazi-Thema, dass sie 5000 Jahre jüdischer Kultur vergessen, die mit dem 20. Jahrhundert nichts zu tun haben. Meine jüdische Kultur ist voll von großartigen Dichtern des 14. Jahrhunderts, von wunderbarer Literatur und vom Theater des 19. Jahrhunderts. Das hat mit Auschwitz nichts zu tun.«
Und weil sich Kosky oft darüber ärgert, nur »tote Juden« auf der Bühne zu sehen, hat er Figaro und Susanna in seiner Berliner Mozart-Inszenierung als jüdisches Paar auf die Bühne gebracht. »Natürlich haben mich alle Berliner Kritiker nach dem Warum gefragt. Und ich habe geantwortet: Warum nicht? Das war überhaupt kein großartiges politisches Statement, sondern ich habe die Oper wie eine Komödie von Mel Brooks aufgefasst, die vor allem Spaß macht. Das ist alles.«
Und was ist mit Wagner, Hitlers Lieblingskomponist, auf dessen Konto so manch gehässige Attacke gegen das Judentum geht? Kosky blickt ruhig auf seine Ringe. »Ich habe zu Soltesz gesagt: Wie kann so ein Schwein so geniale Musik schreiben? Ich kann davon abstrahieren, das persönliche Leben eines Künstlers interessiert mich nicht. Ich bin kein Deutscher, der sich in Wagner spiegelt. Ich bin Jude, aber ich würde niemals ein Stück in der Nazizeit spielen lassen. Das ist banal und kindisch.«
So wird er auch »Tristan und Isolde« nicht als Kampf zweier Menschen gegen eine totalitäre Gesellschaft inszenieren. Sie ist seine »Lieblingsoper von Wagner, weil sie ein Kammerspiel ist, nichts zu tun hat mit deutscher Geschichte oder nordischer Mythologie, nichts mit Goethe oder nationalistischem Humtata.« Kosky hat ein ganz anderes Bild von dem Werk: »Für mich ist es ein Stück über die Einsamkeit der Menschen. Jeder Charakter bis hin zum Hirten ist eine einsame Figur und sucht nach etwas jenseits des täglichen Lebens. So entsteht diese Ekstase, diese hypererotische Leidenschaft, die etwas Morbides hat. Das Stück riecht nach Kadaver, nach Gammelfleisch. Aber es gibt kein Entkommen aus diesem Leben. Die Oper erinnert mich an Strindbergs ›Totentanz‹ oder Becketts ›Endspiel› – man lebt wie Tiere in einem Käfig. Alles ist Schattenwelt, und man fragt sich: Leben diese Figuren eigentlich, oder ist alles ein Traum?«
Die Ausweglosigkeit eines Zwingers will auch die Bühne von Klaus Grünberg heraufbeschwören, über die man am Aalto-Theater den Mantel des Geheimnisses breitet, um den Überraschungscoup nicht zu gefährden. Kein Geheimnis ist freilich, dass Barrie Kosky, der an der Universität von Melbourne Musik studierte, jedes Stück nicht nur konzeptionell erschließt, sondern vor allem über die Partitur. »Musikalisch ist ›Tristan‹ ein unglaublich avantgardistisches Werk. Man hört im dritten Akt schon Schönberg oder Webern – die gesamte Musikgeschichte steckt darin. Aber es ist auch ein Stück über den Klang. Was ist diese ›alte Melodie‹, von der Tristan singt? Ist es der Gesang des Orpheus? Oder ist es die Melodie, von der die talmudischen Rabbis sprechen, wenn sie sagen, dass die Zeit von Musik durchwoben ist?«
Wagners Opus Magnum – das ist die schier unendliche Dehnung der Zeit im Klang, der das Publikum wie ein Ozean überschwemmt und es gleichzeitig darauf trägt. »Tristan und Isolde« ist Wagners unrealistischstes Stück – und damit Oper im wahrsten Sinne. »In unserer Zeit mit Filmen, Fernsehen und Reality Shows ist Oper eines der letzten Rituale, die existieren«, sagt Kosky. »Sie füllt einen Platz aus, den einmal die Religion einnahm. Die Oper kam als Bastard des griechischen Theaters auf die Welt, und ihre Figuren existieren bis heute in einer Rätselwelt. Wagner hat das in ›Tristan‹ noch einmal überwältigend eingelöst. Deshalb vergebe ich Wagner, wenn ich ›Tristan‹ höre. I forgive him!«
Aalto Theater Essen, Premiere von Wagners »Tristan« am 9. Dez., weitere Aufführungen: 17., 23., 30. Dez. und 6. Jan., 6. April sowie 3., 10. und 17. Juni. www.theater-essen.de/