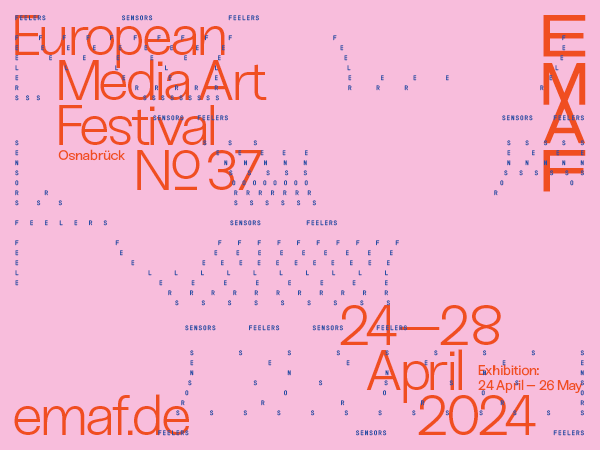Kontinent Shakespeare. Fünf Regisseure betreten dieses noch immer weite Land. Einer (in Wuppertal) tut bloß so, als würde er etwas suchen, und landet im Öden. Ein anderer (in Oberhausen) hat vorher schon alles gefunden und erlebt keine Überraschung mehr. Ein dritter (in Essen) kommt nur bei sich selbst an und dem eigenen Lebensgefühl. Der vierte (in Köln) sucht nicht lange, sondern erobert das nächst liegende Kaufhaus und wühlt in den Sonderangeboten. Einer allein (in Düsseldorf) hat weder Ziel noch Absicht, sondern schaut einfach und entdeckt am meisten. Wenn es nach Jürgen Goschs Vorstellung geht, ist »das Vergnügen am größten, wenn man bei der Probenarbeit anderer in diesem Moment dabei sein könnte«. Etwas sieht und spürt, »bevor die Arbeiten anfangen, Beton zu werden«. Gosch äußerte dies in einem Gespräch mit »Theater heute«. Und sprach von einer »Verschwörung gegen den Apparat «. Als wär’s ein Stichwort für »Macbeth«, den Usurpator, dem das Reich in die Hände gehext wird, die dabei rot von Blut triefen. Leichtsinn und Spielfreiheit, das Unerwartete und Unerlernbare, etwas, das sich nicht zwingen lässt, was passiert – oder eben nicht, macht die Antriebskräfte von Goschs Theater aus. Anarchische Schübe, Leerläufe, irrer Eifer und entfesselte Ruhe, die große Gereiztheit und der große Stumpfsinn sind Elementarteile seiner krass jungen Aufführungen.
Besudelt und verroht ist sein mit sieben Männern besetztes Blutfest »Macbeth« im Düsseldorfer Schauspielhaus. Der Bühnenkasten (Johannes Schütz) für die Nackten und die Toten müllt sich nach dem Hexensabbat chaotisch zu. Über dem Saustall schwebt ein Stück Papier wie ein zerfetztes Segel. Schon in »Sommergäste« (Düsseldorf), »Peer Gynt« (Bochum) und »Virginia Woolf« (Berlin) hat sich Gosch für den schmalen Grat interessiert, der Zivilisation vom Barbarentum trennt. Diese thin red line durchzieht auch »Macbeth« – bis zum Extrem. Es geht an die Wurzel, ist: radikal. Im Gegensatz zum Illusionstheater zeigen Michael Abendroth, Thomas Dannemann, Jan-Peter Kampwirth, Horst Mendroch, Ernst Stötzner, Devid Striesow und Thomas Wittmann die Instrumente. Das heißt: der Schauspieler spielt – mit dem Ball eines Kindes, mit Gezweig (Birnams Wald), mit der Pappkrone, einem Arztkittel, mit Theaterblut. Auf wundersame Weise birgt gerade das Vorführen der »Mittel« den Zauber des Wahrhaftigen. Das Brutale wird umso anstößiger, als es auf das Arglose trifft, wenn etwa ein Mörderquintett mit Grinse-Masken und Gitarrensolo sein Todesspiel durchführt und Genicke knacken lässt. Der Thronräuber (Dannemann) sitzt am Ende da, den »Geschmack der Angst« auf der Zunge und tut und will nichts mehr. Selbst die Sonne hat er satt.
Wie dankbar ist man, kein Konzept-, Demonstrations-, Spaß- oder Betriebstheater zu erleben, wo Zeit nie mal aus den Fugen gerät, sondern fest zementiert ist. Womit wir bei »Hamlet« wären.
Am Anfang ziehen Wachtposten vor dem »Eisernen« von Helsingör auf, so treuherzig wie der Soldat am Wolgastrand der Operette steht. »Als Soldat und brav« – das mag für Valentin im »Faust« reichen, nicht für den Regisseur des »Hamlet«. Thorsten Pitoll hat nichts zu sagen, tut dies aber penibel und erschöpfend umständlich. Ein »Hamlet« der langen Wege, bei denen es im Wuppertaler Schauspielhaus vom Laufsteg oberhalb der Spielszene in braunem Furnier bis ins Parkett geht. Verdächtig droht das allerbeliebteste Requisit, ein Mikrofonständer, auf der Bühne, aber der Stimmverstärker ist auch schnell vergessen. Wie gnädige Amnesie überhaupt die Grundfigur dieser Aufführung ist. Ein konsequenzloses Sammelsurium der Einfälle, Stile und des historisierenden Plunders: Darin wirkt Gertrud wie die böse Königin im Märchen, Polonius und Ophelia wie kleinkarierte Biedermeierlinge, die Höflinge wie von Stefan Raab gemusterte Freizeitmenschen, der Brudermörder Claudius so wenig wie nichtssagend und der Geist von Hamlets Vater wie das Gespenst von Canterbury. Wenn die Rhetorik des Königsdramas demonstriert werden sollte, ist der Vorsatz spannungslos gescheitert, als habe es nie die bereinigte Einfachheit eines Brook, Gosch, Steckel gegeben. Text und Figur fallen auseinander. Das Unfassliche erscheint als schaler Spuk, das Finale dräut symbolisch. Allein um den Hamlet des Thomas Birnstiel ist’s schade. Für das offensiv Klare und Innerliche des Feingeists hätte es andere Räume gebraucht, vor allem gedankliche. Die Übersetzung Heiner Müllers bot Gelegenheit, den Autor auch im Programmheft zu zitieren. Müller stellt »die ungeheuer komplexe organische Struktur« Shakespeares gegen den schlichten Brecht. Aber es hieße BB zu verleumden, würde man behaupten, wenigstens dessen Prinzipien hätte Pitoll beherzigt. Der Abend legitimiert sich weder ästhetisch noch ideologisch oder sonst wie. Nicht einmal durch Jugendlichkeit. Womit wir bei David Bösch in Essen wären, wo im Grillo-Theater Anselm Webers Intendanz begann.
Bösch ist eigentlich noch zu jung, um forever young sein zu müssen. Er tut aber schon – oder noch – so, als sei dies sein Signet. Flachst und albert sich durchs Stück, in dem Theseus (Günter Franzmeier) ein mieser Gewinnler und Hippolyta (Bettina Engelhardt) seine Russenbraut und deren Athener Rahmenerzählung ein Stück abgefuckter Erwachsenenwelt sind. Hermia, Helena, Demetrius und Lysander schickt der Naturkunde-Lehrer Bösch in die neuromantische Schule und andererseits ins Kino. Denn im Fantasy-Wald (Bühne Dirk Thiele) blüht den Bravo-Boys und -Girls der Teen Horror von Splatter-Movies, der sie selbst in Zombies verwandelt. Die erogene Zone wird zwar häufig gekitzelt, aber doch ziemlich verdruckst – für die Generation Gucci eher erstaunlich, oder haben wir da was verpasst? Es bleibt beim Voyeurismus geölter Model-Elfen-Ragazzi und bei kicherndem Petting. Entsprechend idealtypisch sind die Handwerker zur Boygroup geschrumpft. Von ihren Szenen bleibt nur: Pop. Und immerhin eine Überraschung: Zettels Staunen, wenn er Puck (Sarah Viktoria Frick) begegnet. Der Geist erhält – ein anderer Ariel –am Ende die Freiheit und erblüht wie die Sangesmaid Björk. Vielleicht hätte daraus eine wunderbare Liebesgeschichte werden können. Aber das wäre ein anderes Stück gewesen.
Geschäftsmäßig geht’s weiter – zur Konferenz ins Schauspiel Köln. Dort steht ein Chefsessel auf der Bühne, hasten Männer mit Aktenkoffern, Aktienkurse wispernd. Aha, Manager am Rialto! Die Business-Class löst die »Kaufmänner von Venedig« ab. Das hatten wir schon mal, bei Zadek in Wien – nur besser. Geblieben ist bei Regisseur Michael Talke die Übersetzung von Elisabeth Plessen. Die Anzugträger geben sich alert, Antonio ist einer von ihnen, höchstens melancholisch schnarrender (aber das liegt an Martin Reinke), Shylock ebenfalls, vielleicht etwas schärfer und schneidender. Aber wenn er seinen großen Monolog hält, klingt es, als würde Markus Scheumann eine Jahresbilanz vortragen. Business as usual. Weil die ganze Gesellschaft sich gleicht, muss die Kluft anders spürbar werden. Ausländerwitze heizen die Atmosphäre auf, das Publikum reagiert provoziert – willkommen in der pädagogischen Provinz. Das Milieu um Porzia und Jessica glitzert modisch, ramschig, teuer im Schick von Glückslotterie und Ferienclub. Diese soziale wie mentale Geschmacklosigkeit lässt nicht glauben, dass da Intelligenz bestünde, einen Gerichtsfall wie den von Shylock zum trickreichen Finale zu führen. Zwischen all den Figuren existiert: nichts – außer einem leeren falschen Theaterton. Nichts dahinter. Womit wir in Oberhausen wären. | AWI
Was der Beatles-Song »Sgt. Pepper’s« von 1967 mit der Shakespeare-Tragödie »König Lear« von 1604 zu tun hat, wissen der Himmel und Johannes Lepper, der Oberhausener Intendant, der zur Eröffnung seiner dritten Spielzeit beide Werke gemeinsam auf die Bühne brachte. Es taucht der Rocksong aus dem Swinging London den Auftakt des tieftragischen Dramas in ironische Leichtigkeit. Zumal die Grafen Kent und Gloster eine schmissige Come-in-Show beisteuern.
Doch ist nichts dahinter und es nicht so gemeint. Mit dem letzten Klang wechseln Takt und Tonart zu Grimm und Düsternis, und gibt es auch hier und da eine weitere Nummer aus jenem Beatles-Album, der Sound der Inszenierung wird Heavy Metal. Nämlich finsteren Akkords, brüllend laut und variationslos auf der Stelle stampfend.
Nichts entwickelt sich, alles ist sofort am Ende. Lear (Otto Schnelling) ist ein böser, alter Säufer, der aus reiner Schuftigkeit sein Reich unter die Töchter teilt. Dass die Schwestern Goneril (Sabine Wegmann) und Regan (Ruth E. Spichtig) gierig sind, versteht sich, weshalb sie so artifiziell verdreht sind, wiederum nicht. Doch auch Cordelia (Franziska Werner) ist trotzig-patzig-kalt. Weil es, wenn die Dramatik zwischen den Figuren suspendiert ist, dennoch Spannung braucht, kommt Geschrei aus allen Kehlen. Immerzu. Not, Leid, Verzweiflung, Angst – Gebrüll ist der Ausdruck. Verrutscht die Lärmdecke jedoch einmal, lassen sich kleine, einfallsreiche, dichte Szenen sehen, vor allem zwischen Lear und seinem Narren (Marek Jera) oder in der Figur des Kent (Jeff Zach) als Samurai mit Wiener Zungenschlag – man frage auch hier nicht, warum! Immerhin hat es Witz. Witzlos hingegen der Wassertümpel in Bühnenbreite, der alle Figuren nach Minuten nass, aber auch nach dreieinhalb Stunden kein bisschen reicher gemacht hat (Bühne: Martin Kukulies). Der Höhepunkt des Stücks, Lears De profundis auf der sturmgepeitschten Heide (III, 2), wird dann zum Tiefpunkt: Die Weltzerfallenheit lastet auf den Schultern der Nebelmaschine, der Schauspieler versagt. Um uns hinfort mit seiner baumelnden Nacktheit zu erheitern. | UDE