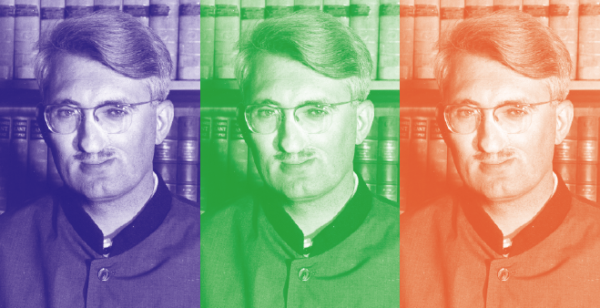TEXT: JÜRGEN KAUBE
Die alte Bundesrepublik, wie sie inzwischen manchmal genannt wird, hatte es mit dem Diskutieren. Volkstümlich nahm es die Form des Streitgesprächs am Stammtisch an, etwas gehobener die der Tagung an evangelischen oder katholischen Akademien, massenmedial erschien es zunächst als »Internationaler Frühschoppen«, um dann in Form der Talkshow aufzutreten. Politologen glauben sogar, es mit einem Beweis für die »Zivilgesellschaft« zu tun zu haben, wenn die Zahl der Diskussionsforen steigt. In den Schulen hat das Diskutieren den Elternabend, die Schülermitverwaltung und die Kritik des Frontalunterrichts hervorgebracht. In den Familien ist Erziehung durch Diskussion längst so üblich geworden, dass ganze Pädagogiktheorien darüber streiten, ob es sich um eine eigene Methode oder bloß um eine Sackgasse handelt. Und philosophisch spricht man seit längerem schon vom »Diskurs«, wenn man eine Abfolge von Schriften meint, und gibt dadurch zu verstehen, dass selbst Nichtdiskussion sich noch als Diskussion interpretieren lässt.
Kein intellektuelles Werk entspricht dieser jüngeren deutschen Tradition mehr als das des Philosophen Jürgen Habermas, der am 7. November auf dem Petersberg bei Bonn für sein Gesamtwerk den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten wird. Kaum eine öffentliche Debatte der Bundesrepublik – vom »Positivismusstreit in der Soziologie« und der Kritik an der »Tendenzwende« zum Neokonservatismus, über den Historikerstreit, den »DM-Nationalismus« (so Habermas) der Wiedervereinigung und die Gentechnik, bis hin zum europäischen Protest gegen den zweiten Irakkrieg – an der Habermas nicht federführend teilgenommen hat. Seine fortlaufende Sammlung »Kleine Politische Schriften«, die inzwischen beim zehnten Band angelangt ist, liest sich wie eine Chronik des diskutierenden und protestierenden Landes. Das kann man außer von Habermas eigentlich nur noch von den Essays und Projekten seines Altersgenossen Hans Magnus Enzensberger sagen.
Doch nicht nur sein ideenpolitisches Engagement, auch seine sozialphilosophischen Grundlinien sind durch und durch vom Gedanken des öffentlichen Gesprächs bestimmt. Berühmt geworden ist Habermas, der in Bonn studiert hatte und, nach der dortigen Promotion 1954, in Frankfurt in der Nähe Adornos und Horkheimers zur Wissenschaft fand, durch seine Habilitationsschrift, über den »Strukturwandel der Öffentlichkeit« von 1961. In ihr wird die Geschichte der bürgerlichen Meinungsbildung durch politische Diskussion, ihren Aufstieg in den liberalen Kreisen der englischen und französischen Intellektuellenwelt vor 1800 und ihren Verfall im Zeitalter der Massenmedien nachgezeichnet. In seinem Hauptwerk, der »Theorie des kommunikativen Handelns« von 1981, hat er die systematische Begründung für diese Klage über das Schicksal der diskutierenden Aufklärung geliefert.
Jede Behauptung, so der Grundgedanke von Habermas, verweist auf soziale Bedingungen, unter denen geklärt werden kann, ob sie zutrifft oder nicht. Wer über einen Sachverhalt urteilt, setzt stets voraus, dass er »die Zustimmung jedes kompetenten Beurteilers finden würde«. Konsens ist also ein Wahrheitskriterium in Diskussionen. Zumindest dann, wenn die Gesprächspartner als kompetent, mithin als vernünftig gelten dürfen. Aber wer soll das feststellen? Die Antwort des Philosophen: die ideale Sprechsituation. Bei jedem Gespräch, so meint er, unterstellen wir, zu einem Konsens gelangen zu können. Und zwar zu einem echten, nicht zu einem erpressten oder zu einem nur vorgetäuschten. Sobald wir diskutieren, haben wir eine ideale Sprechsituation im Sinn, in der sich zweifelsfrei klären ließe, was zutrifft. Für diese ideale Situation gilt: Alle von der anstehenden Frage Betroffenen werden zum Gespräch eingeladen. Das Gespräch selber ist frei von systematischen Verzerrungen der Kommunikation. Die Beteiligten sind also nicht müde, genervt, sowieso sauer oder am sofortigen Schluss der Debatte wegen des Anpfiffs zum Länderspiel interessiert. »Nur dann« nämlich »herrscht der eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Arguments«. Solche Bedingungen sind natürlich nur selten gegeben. Aber sie werden, so Habermas, unterstellt. Das führt ins Zentrum seiner Wertschätzung des Diskutierens: dass hier eine bessere Welt, eine ohne strategische Absichten, Gewalt und Ungleichheit kontrafaktisch in Anspruch genommen wird.
In der idealen Sprechsituation werden also Argumente, nicht Schläge oder Provokationen oder schlechte Launen ausgetauscht. Es geht um gute Begründungen. Folgerichtig waren die Gebiete, auf denen sich Habermas seit jeher zuhause fühlte, solche, in denen mehr oder weniger demokratisch geführte Debatten eine besondere Rolle spielen: Massenmedien, Politik, Recht, die Universitäten. Die Wirtschaft hingegen, sowie Naturwissenschaft und Technik bleiben ihm eher fremd. Nachdem er 1971 zum Direktor des »Max Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlichtechnischen Welt« in Starnberg ernannt wurde, dauerte dieser Ausflug in die soziologische Forschung, jedenfalls nach Maßstäben der Max-Planck-Gesellschaft, nicht lange. Das Institut wurde 1981 wieder geschlossen.
Für Habermas ergab sich die Präferenz für demokratienahe Themen, ja für Demokratie als Maßstab rationaler Gesellschaftsgestaltung vermutlich auch vor dem Hintergrund von Jugenderfahrungen. Auch er gehörte, 1929 in Düsseldorf geboren und in Gummersbach aufgewachsen, zur Hitlerjungen- und Flakhelfergeneration und bezeichnete sich später als »Produkt der re-education«. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er noch als Student in Form einer Besprechung von Martin Heideggers »Einführung in die Metaphysik«, die er 1953 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Dokument schlecht verhohlener nationalsozialistischer Impulse beschrieb. Heidegger hatte eine Vorlesung von 1935 publiziert, als sei inzwischen nichts geschehen. Dass Denken ein politischer Akt sei und man philosophische Interessen von gesellschaftlichen Implikationen nicht trennen könne, daran hat Habermas seitdem festgehalten.
Damit war der Theoretiker des Konsenses nicht nur an zahllosen Konflikten beteiligt. Er hat sich in ihnen auch den Optimismus erhalten, der in jeder Diskurstheorie steckt. Vermutet sie doch, dass sich die drei Aspekte jeder Diskussion – Worum geht es? Wer nimmt teil? Wie lange dauert das? – gegenseitig befördern. Wenn man allen Betroffenen Zeit zum Ausreden gibt, kommt schon etwas Richtiges heraus. Wenn man das, was wirklich jeden angeht, jedem völlig klarmacht, kommt zügig Konsens zustande. Wenn man über das Wichtigste nur lange genug spricht, dann steigt die Einsicht aller Beteiligten. Kritiker der Diskursethik, prominent Habermas’ langjähriger Antipode, der Soziologe Niklas Luhmann, haben hiergegen eingewendet, dass sich in der Wirklichkeit vielfältige und wechselseitige Leistungseinschränkungen beim Diskutieren zeigen. Je mehr an der Diskussion teilnehmen, weil es um etwas Wichtiges geht, desto auffälliger wird, dass mancher gerade andernorts dringend benötigt würde: die Betriebsversammlung. Je länger es dauert, weil viele das Wort ergreifen, desto weniger lässt sich rekonstruieren, worum es überhaupt gegangen ist: die Satzungsänderungsantragsdebatte. Je klarer es sich schließlich herausstellt, worum es eigentlich geht, indem es umständlich auseinandergesetzt wird, desto unvermeidlicher ist, dass sich niemand mehr angesprochen fühlt: das Verkaufsgespräch.
In den 80er Jahren jedenfalls wurde allmählich das Nichtdiskutierenwollen zur Geste derjenigen, die sich von 1968ern, zu denen Habermas dem Alter nach allerdings nicht zählte, belästigt fühlten. Es kamen die Punk-Musik, die Postmoderne und die Individualisierung durch Verweigerung von guten Gründen. Und es kamen Theorien aus Frankreich, die es mehr mit dem Körper hatten, mit der Schrift, der Ohnmacht des Geistes und mit der Vermutung, die Einladung zum Diskutieren sei nur ein Trick der Besserwisser.
Jürgen Habermas hat selbst auf solche Widerstände mit dem Versuch reagiert, sie im »Philosophischen Diskurs der Moderne« (1983) als sich selbst missverstehende Gestalten von Aufklärung zu deuten. Diese Neigung hat einmal einer seiner Schüler auch am Lehrer Habermas beschrieben. In Seminaren soll er Beiträge der Studenten gern mit klassischen Positionen der Philosophie identifiziert haben. Wie in seinen Schriften auch, hatte er die größte Begabung im Zusammenfassen. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann machen Sie hier einen pragmatistisch gelesenen Kant gegen den Hegelmarxismus von Adorno stark.« Der Student hatte dabei wohl meistens weder Kant noch gar die Pragmatisten oder Adorno gelesen – tat es aber um so gewisser nach der Stunde, um herauszufinden, was für einen Klassiker man da gerade ganz unabsichtlicherweise vertreten hatte! So behandelte Habermas auch im Seminar die Sprecher »idealisierend« und sah in ihren Beiträgen weniger, was sie faktisch waren, als das, was sie kontrafaktisch, ihrer besten Möglichkeit nach, hätten sein können. Die akademische Schülerschaft, die ihm auf diese Weise entstand, ist umfangreich, Habermas hat eine ganze Generation von Sozialphilosophen geprägt. Auf diese idealisierende Weise hat der Philosoph es aber auch mit anderen Sachverhalten gehalten: Mit dem Marxismus etwa, mit der Westbindung der Deutschen, mit der Religion, die er spät als einen Bündnispartner gegen den Naturalismus der technischen Zivilisation entdeckte, und zuletzt mit Europa. Und eben das hat ihm eine für deutsche Intellektuelle ganz beispiellose Weltgeltung eingetragen: die Fähigkeit, nicht den Tatsachen Ideale entgegenzusetzen, sondern zu begründen, die Tatsachen selber enthielten diese Ideale.