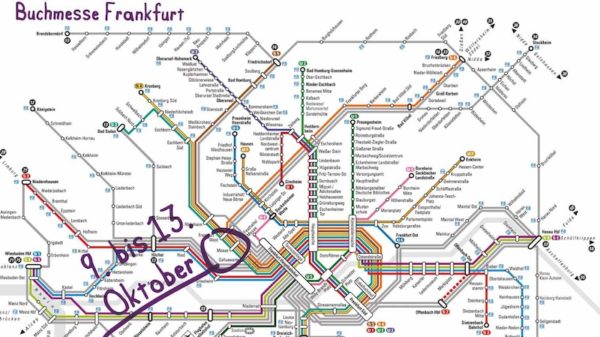SPRACHLEUCHTEN
Marion Poschmann lotet die »Sonnenposition aus.
Wenn seine Patienten ihre Familiensituation als Obstkorbstillleben nachstellen sollen, hält Altfried Janich sich selbst am liebsten für eine Pomeranze. »Perfekt gerundet und relativ stoßfest, von einer in sich ruhenden Fülle«, womit Gemüt und Leibeskonstitution des Rheinländers treffend zur Anschauung kommen. Wichtiger aber noch ist, dass die Bitterorange aus China, »dem Land der aufgehenden Sonne«, stammt. Denn der eigenbrödlerische Psychiater reklamiert als Ich-Erzähler gleich eingangs von Marion Poschmanns neuem, für den Buchpreis nominierten Roman »Die Sonnenposition« für sich, von der »Sonnenwarte« aus zu erzählen, mit dem »allsehenden Auge des Arztes«.
Janich praktiziert in einem maroden, zur Heilanstalt umfunktionierten Barockschloss in Ostdeutschland, wo vornehmlich Wendeverlierer therapiert werden, Menschen, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs am Verlust von Solidarität und Sinn leiden. Ihre Tage versucht Janich, der sich manchmal selbst für einen seiner Patienten hält, aufzuhellen, in ihre Psyche hineinzuleuchten. Dabei weiß er nur zu gut – als Psychiater wie als Erzähler –, dass unter der ausgeleuchteten Oberfläche so manches verborgen bleibt. Und das klingt auch in seinem altertümlichen Namen an: Denn Altfried bedeutet nicht nur Friedensbringer, sondern auch Elfenfürst, was auf Alberich anspielt, den Hüter des Nibelungenhorts, der sich mit einer Tarnkappe unsichtbar macht. Was Marion Poschmann in unsere Gegenwart übersetzt: Altfried geht in seiner Freizeit mit der Kamera »Erlkönige« jagen, Automodelle, die kurz vor ihrer Markteinführung stehen und unter realen Bedingungen unkenntlich gemacht auf abgelegenen Strecken getestet werden.
Vordergründig ist Marion Poschmanns dritter Roman arm an Ereignissen. Dünn ist das Handlungsgerüst, oder besser: filigran. Es entfaltet sich in Rückblicken um das komplizierte Beziehungs-geflecht zwischen Altfried, seiner Schwester Mila und dem verstorbenen Jugendfreund Odilo, dem Biologen und Experten für selbstleuchtende Lebewesen. Bruchstückhaft wird die Familiengeschichte der Geschwister erzählt, die Ermordung der Großeltern in Polen, die Flucht des Vaters. Der Erzähler referiert, stark komprimiert, zehn psychopathologische Fälle. Das klingt nach mehr Stoff, als es sich liest. Doch was sich in diesem Roman ereignet, ist die Sprache.
Die 1969 in Essen geborene Marion Poschmann ist auch und vor allem eine Lyrikerin von hohen Graden. In ihren Gedichten hat sie die Sprache zu einem sensitiven Wahrnehmungsinstrument raffiniert, das ihrer Prosa eine präzise Eigenwilligkeit verleiht. Feiner ziselierte, abgründigere Charaktere dürften derzeit in nicht allzu vielen deutschsprachigen Romanen anzutreffen sein, durchdringendere Alltagsbeobachtungen auch nicht. | ANK
Marion Poschmann: »Die Sonnenpostion«; Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 2013, 340 S., 19,95 Eur. Lesung am 5. November 2013 im Eulenspiegel Buchladen, Bielefeld
DIRTY HARRY IM ALPENLAND
Jochen schickt einen Lehrer in den »Krieg«
Ein Waldhaus in Österreich, ein Hütte an der Baumgrenze. Hier lebt Arnold Steins: Nach dem Tod seines Sohnes in Afghanistan und dem Suizid seiner Frau hat sich der frühere Geografielehrer ans Ende des Wegenetzes verkrochen, des öffentlichen wie seines biografischen. Steins versteinert. Und lebt – wenn man dies so nennen kann – erst wieder und als ein anderer auf, als ihm durch den Angriff eines ihm bis zuletzt Unbekannten auf seine Hütte, seinen Hund und ihn selbst ein Feind erwächst. Der Entschluss, diesen zu vernichten, beschert Arnold eine innere Klarheit, so groß, wie der austriakische Himmel blau ist: »Jetzt ist es anders. Jetzt ist er im Krieg.« Carl Schmitt lässt grüßen.
Jochen Rausch, 1956 geborener Wuppertaler, Wellenchef von 1Live, ist 2011 mit dem Erzählband »Trieb« hervorgetreten, in dem er kurz und lakonisch schreckliche Nachtseiten normaler Menschen servierte. Derselbe Teig zur Romanlänge ausgewalzt aber wird dünn und schmeckt fad. (Behauptetes) Kernproblem von »Krieg« ist die Angst, die Arnold und seine Frau lähmte und die der Sohn nie hatte. Angst allerdings ist etwas im Inneren des Menschen. Und eine solche Ebene kennt dieser Roman nicht. Sein Protagonist bleibt ein unvollständiger Umriss, seine Sprache will ohne Bilder auskommen. Die parataktische Lakonie aber verdeckt nichts Ungesagtes, weil es Ungesagtes hier nicht gibt. Knapp unter der Oberfläche lassen sich die Konstruktionsprinzipien erkennen; unterläuft eine Metapher, ist sie abgegriffen – da ist der »Himmel ein tiefschwarzes Tuch«, liegt ein See wie ein Smaragd, »zersägt« ein Telefon »die Stille«. Die Wandlung vom kleinbürgerlichen Beamten aus dem Taunus zum wortlosen Vollstrecker à la Clint Eastwood bleibt behauptet. Der Roman hält eine gewisse Spannung auf der Makroebene, weil der Leser lange nicht weiß, wer in diesem Zweikampf mit Feuer- und Bolzenschussattacken obsiegt. Doch wenn ein Mann rot sieht, trifft er auch, weiß Autor Rausch. So kann der völlig schießungeübte Arnold in tiefschwarzer Nacht seinen Feind vom Hochstand aus mit einem Gewehr, das er praktischerweise in der Hütte versteckt fand, erledigen: »Der Stärkere besiegt den Schwächeren. So geht es im Krieg.« Und kann am Schluss mit einer Anne, die ihm zu- und ein wenig nachgelaufen ist, in den Sonnenuntergang reiten. Will sagen, mit dem Pick up ans Meer und mit der Fähre hinaus fahren. In den Frieden vor dem nächsten Krieg. | UDE
Jochen Rausch: »Krieg«; Berlin Verlag, Berlin 2013, 256 S., 18,99 Euro. Lesungen: 6. Oktober 2013, Alldie, Velbert; am 15. Oktober 2013 im Pantheon, Bonn
ZUSAMMEN ALLEIN
Debüt I: Hannah Dübgens »Strom«
Dünne, farbige Linien, die parallel zueinander verlaufen und aus der Ferne betrachtet doch eine Einheit, ein flirrendes Miteinander bilden – Hannah Dübgen hat für den Umschlag ihres ersten Romans »Strom« nicht ohne Hintergedanken ein Bild aus Gerhard Richters Serie »Strips« gewählt. In Richters Linien sieht sie die »Lebenslinien« ihrer vier Protagonisten veranschaulicht – Ada, die mit ihrer Freundin Judith eine Dokumentation über den Gazastreifen dreht; die junge japanische Pianistin Makiko, die nach Paris gezogen ist, um in Europa Konzerte zu geben. Der brasilianische Zoologe Luiz, der mit seiner jüdischen Frau und zwei Kindern in Tel Aviv lebt, und der amerikanische Investmentmanager Jason, der in Tokio die Übernahme eines japanischen Traditionsunternehmens organisieren soll.
»Nah oder fern gibt es nicht mehr, nur noch nah oder fremd.« Keiner dieser vier Menschen scheint am richtigen Platz zu sein, in allen Bindungen und Beziehungen bleiben sie meist Fremde – sich selbst und dem Land gegenüber. Was sie eint, ist der Himmel; immer wieder werden Blicke ins Blaue gerichtet und Makiko erinnert sich in dem Moment, an dem sie sich von allen verlassen fühlt, an ihren Großvater, der ihr einst erklärt hatte, »was der Trick des Horizonts war, warum er sich in genau dem Maße, in dem wir auf ihn zugingen, von uns entfernte.«
Dübgen, 1977 in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, lässt diese »Lebenslinien« autark verlaufen; jedenfalls am Anfang des Romans, wenn sie kapitelweise zwischen den einzelnen Personen hin- und herwechselt. Später sind es die Nebenfiguren, die die Erzählstränge immer mehr miteinander verknoten und die Leben von Ada, Makiko, Luiz und Jason quer über den Globus verbinden. Erst ganz am Ende, in einem atemlosen Kapitel, finden sich alle in Israel wieder, »einem Ort, der seit Jahrtausenden Durchgangsstation für Menschen und Vögel gewesen ist«. Es ist letztlich die Musik Makikos, die die losen Seelen, die wie Zugvögel um den Globus gleiten, verbindet.
Hannah Dübgen wurde für ihr Debüt der Förderpreis Literatur der Landeshauptstadt Düsseldorf 2013 zugesprochen. | VKB
Hannah Dübgen: »Strom«; dtv premium, München 2013, 272 S., 14,90 Euro
EIN TAG REIST IN DIE NACHT
Debüt iI: Martin Krumbholz’»Eine kleine Passion«
Ein warmer Julitag 2011. Christof Rubart ist Kustos in einem Düsseldorfer Museum. Am folgenden Tag beginnt die Ausstellung »Deutsche Malkunst«; Rubart wird hier die Selbstporträts Dürers denen seines Lieblingsmalers Martin Kippenberger gegenüberstellen. Mit den letzten Vorbereitungen der Vernissage beginnt sein Tag, der Tag, von dem das Buch erzählt. Rubart hat während dieser Zeit unzählige Begegnungen mit Menschen – nicht nur aus dem Künstlermilieu Düsseldorfs. Er besucht seinen 101-jährigen Vater im Seniorenheim, geht zum Frisör, macht Mittag mit Freunden, trifft seine Tochter Stella und ist doch vor allem mit einem beschäftigt: der Liebe. Seiner Liebe zu Frauen, die in der Kindheit mit der 13-jährigen Meike begann und nun bei Sophie angelangt ist, seiner aktuellen Beziehung. Beim Besuch des Vaters, eines ehemaligen Shakespeare-Forschers, zitiert dieser einen Satz aus Hamlet: »Was wir ersinnen, ist des Zufalls Spiel«.
Die Kontingenz des Zufallenden, dies könnte das Lebensmotto Rubarts sein, das der Düsseldorfer Theaterkritiker und -autor Krumbholz in seinem Debütroman exemplarisch anhand der Geschichte eines – bis tief in die Nacht währenden – Tages entfaltet. Dabei wird der Leser Zeuge eines Lebens im Zeitraffer, eines Lebens, durch das Rubart gleitet, das der Müßiggang prägt – Sophie wie Ruth, Stellas Mutter, die er wegen Sophie verlassen hat, sind so etwas wie teilhabende Zeuginnen dessen; in Rückblenden fließen diese Liebesverwirrungen ein. Rubart sucht zwar nach einer Struktur für diese Lieben, weiß aber: »Das Leben (ist) eine Kette von Verliebtheiten, nur kurz abgerissen, jedes einzelne Glied anders geformt, kaum dass du von einer einzigen Episode sagen könntest, wie du hinein- und wieder hinausgeraten bist.« Anspielungsreich verschafft der Roman diesen Geschichten der Liebe christologische (Passionsgeschichte) sowie philosophische und literarische Bezüge – Überhöhungen, die dem Erzählten nicht immer gut tun.
Nicht nur die Tatsache, dass der Roman an einem Tag spielt, erinnert an »Ulysses«, auch die Begegnungen Rubarts spielen auf James Joyce an. Etwa die mit der Prostituierten Lisette oder mit einem Fremden auf einer Party, der ihm seinen Charakter diagnostiziert. Der Held ergibt sich diesen zufälligen Begegnungen, ohne sich ihnen hinzugeben. Das ist befremdend und spannend zugleich zu lesen und doch weit weg von der literarischen Inspirationsquelle. So lässt sich sagen, Martin Krumbholz hat mit »Eine kleine Passion« einen Roman geschrieben, der auch von seiner eigenen Passion zu »Ulysses« erzählt. | TEA
Martin Krumbholz: »Eine kleine Passion«; Ch. Schrœr Verlag, Lindlar 2013, 207 S., 17,99 Euro. Lesung am 14. Oktober im Theater die Wohngemeinschaft, Köln
PILZE IM MUND
Ab in die Drogenzone: Selim Özdogans »DZ«
Nicht wenige Schriftsteller haben den Hintereingang zum Paradies in der Apotheke gesucht. Thomas De Quincey half der Einbildungskraft mit Halluzinogenen auf die Sprünge, Ernst Jünger ließ sich vom LSD-Erfinder Albert Hofmann persönlich auf bewusstseinserweiternde Reisen schicken – in der Hoffnung, die Trips würden sich positiv auf die literarische Produktivität auswirken. Um das künstliche Glück verdauen zu können, müsse man zunächst den Mut haben, es zu schlucken, schrieb Charles Baudelaires in seinem Rausch-Essay. Gut 150 Jahre später hat der 1971 geborene Kölner Schriftsteller Selim Özdogan in seinem neuen Science-Fiction-Roman »DZ« zumindest die rechtlichen Hürden dafür aus dem Weg geräumt. »DZ«, das steht für Drogenzone, die irgendwo in Südasien liegt und mit grenzenlosem und legalem Drogen-Zugang für sich wirbt, dabei aber durchaus totalitäre Züge trägt – während in Europa die restriktivste Drogengesetzgebung aller Zeiten in Kraft getreten ist.
DZ kürzt aber auch die Namen der ungleichen Brüder Damian und Ziggy ab, aus deren Perspektive der Roman über weite Strecken erzählt wird. Vor Jahren haben sie sich aus den Augen verloren und seitdem nichts mehr voneinander gehört: Damian hat der Freiheitsdrang in die DZ geführt, von wo aus er Drogen in alle Welt verkauft; der auf Traumforschung spezialisierte Neurologe Ziggy führt mit seiner Familie diesseits der Grenze zum künstlichen Paradies ein gutbürgerliches, ihn zutiefst unbefriedigendes Leben. Ihrer krebskranken Mutter bleiben noch ein paar Monate, um zwei letzte Wünsche erfüllt zu bekommen: eine ordentliche Portion LSD und ein Wiedersehen mit Damian. Also macht Ziggy sich auf die Suche.
Soweit die Ausgangslage dieses Romans, der durch Drogen-Internetforen und Chatrooms führt, in dem das ABC der Rauschmittel detailversessen von Alpha-Methyltryptamin über Cimbi-36, Metocyn, Psilocybin bis hin zu Yohimbe durchbuchstabiert und ein ganz neuer, das menschliche Bewusstsein vollends entgrenzender Stoff namens »wmk« erfunden wird. Der lässt Wörter miteinander »kopulieren«, auch Körper vereinen sich nach Leibeskräften in diesem Roman, dem es an Einfallsreichtum nicht mangelt. Özdogan handelt von der menschlichen Willensfreiheit, vom Überwachungsstaat, der Durchkommerzialisierung jedweder Utopie und dem sinnerfüllten Leben. All das wird angerissen, nicht entwickelt, und bleibt als bunt gemischte, ayurvedisch inspirierte (»Ihre Doshas schienen weitgehend ausgeglichen zu sein, mit einer leichten Betonung auf Pitta«) Themensammlung ohne länger anhaltende Nachwirkungen – einmal abgesehen von der schweren Verdaulichkeit. | ANK
Selim Özdogan: »DZ«; Haymon, Innsbruck 2013, 384 S., 22,90 Euro. Lesung am 25. Oktober 2013 im 1Live Haus, Köln
AUGENTRUG
Debüt III: David Schönherrs»Der Widerschein«
In seiner Rezension von Michael Frayns Kunstwerk-Roman »Das verschollene Bild«, in dessen Zentrum ein Gemälde Pieter Bruegels aus dem Jahreszeiten-Zyklus steht, fasst Schriftstellerkollege Hanns-Josef Ortheil sein Urteil so zusammen: »Am Ende erweist sich die Romanidee als zu stark und die Erzählkunst des Autors zu schwach.«. Ähnliches lässt sich über David Schönherrs »Der Widerschein« sagen. In den Niederlanden ist das Goldene Zeitalter, jene legendäre Epoche der Blüte von Wissenschaft, Künsten und Handel, von Religionsfreiheit, Urbanisierung und Kultivierung, vorüber; die Vereinigten Provinzen fallen in Stagnation. Der Kunstmarkt, der im 17. Jahrhundert wohl an die 70.000 Bilder verdaut hatte, liegt übersättigt danieder. Wer wollte mit Rembrandt, Hals und Vermeer konkurrieren?
Ferdinand Meerten aber – Findelkind, Wunderknabe, Sonderling, Genie und Monstrum – kann zeichnen, dass niemand das Resultat im Kopf aushält. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheim gegeben – oder seinem sanfteren Bruder, dem Schlaf. Ferdinand wächst bei einem Pfarrer auf, geht in die Lehre beim Konventions-Maler Bros, gerät in die Fremde, an eine Kräuterhexe, an fahrendes Volk, schließlich ins Irrenhaus. Der Kontakt mit dem Jungen, der seinen jeweiligen Bezugspersonen zunächst Glück und Gelingen zu bringen scheint, und seiner manisch produzierten, suggestiven Kunst führt zur Besessenheit. In Meertens Rätsel- und Wimmelbildern lauert unter der Oberfläche eine gefährliche zweite Wirklichkeit, die jeden infiziert, ihm zur Selbstbegegnung wird und Phantomschmerz auslöst. Wünsche und Ängste materialisieren sich in ihnen. Und der Mensch wird gänzlich entleert durch die Fülle des Augentrugs.
Man denkt sofort an Patrick Süskind und seinen Roman »Parfum« über den Mörder Jean-Baptiste Grenouille, der in Paris 1738 zur Welt kam, exquisiten Geruchssinn besitzt und es in der Destillation von Düften zur Vollendung bringt. Der Dunstkreis wird mit allen Finessen sinnlicher Lust erfüllt. Eine Qualität, die dem 1980 am Niederrhein geborenen, als Theatermacher in Leipzig lebenden Schönherr für seine Stoffverarbeitung fehlt. In ihrem plakativen Verlauf verfügt die ungeheure Geschichte dramaturgisch eher über die intellektuelle Potenz von Indiana Jones. Schönherrs trockener Stil lässt zu wenig Überschwang spüren, er verzahnt die historische Zeit kaum mit dem Schicksal seiner Figuren und bleibt den Charakter seines einsamen, stillen Helden schuldig. Schade, dass der Sog der Meerten-Bilder sich nicht auf Schönherrs Sprache überträgt. | AWI
David Schönherr: »Der Widerschein«; Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 2013, 254 S., 19,90 Euro. Lesung am 1. November 2013 im 1Live Haus, Köln
VOM KRIEG GEZEICHNET
David Schraven und Vincent Burmeister erkunden »Kriegszeiten«
Was Auszeichnungen angeht, ist »Kriegszeiten« schon jetzt in der falschen Schublade. David Schravens und Vincent Burmeisters Comic über den Afghanistan-Konflikt ist für den Deutschen Jugendbuchpreis nominiert. Das ist einerseits erfreulich, andererseits beinahe ärgerlich. Warum? Weil »Kriegzeiten« eine Reportage ist, die sich nicht an Jugendliche richtet. Zumindest nicht primär. Comics scheinen hierzulande immer noch am Micky-Maus-Ruf zu leiden. Andere Länder sind da weiter. Siehe Amerika, wo Alan Moores »Watchmen« jüngst in die Time Magazine Top 100 der besten englischsprachigen Romane aufgenommen wurde. Ein Comic. O tempora o mores.
Um ein »Jugendbuch« zu schreiben, hat der Bottroper Journalist David Schraven eine Menge Aufwand betrieben. Er hat Tausende von Wochenberichten der Bundeswehr gesichtet. Diese Dokumente sind dazu da, den Bundestag über die Lage in Afghanistan zu informieren. Außerdem hat er Veteranen interviewt, einige von ihnen waren vor Ort an Gefechten beteiligt. Schraven, Jahrgang 1970, war selbst mehrfach am Hindukusch, zuletzt als »embedded journalist« bei einer Bundeswehr-Einheit in Masar-i-Sharif. Stoff genug für eine detaillierte Reportage. Diesen Stoff hat der Hamburger Comic-Zeichner Vincent Burmeister in Bilder verwandelt, deren monochrome Kargheit ausgesprochen passend wirkt. Die Grundthese der Reportage fasst Schraven am Ende des Buches in einem Satz zusammen: Der Krieg ist verloren. Wieso, das erfährt man auf den 120 Seiten zuvor.
Afghanistan erscheint darin kaum als Land. Eher als eine Ansammlung von Stammesgebieten mit wenig oder gar keinen Gemeinsamkeiten. Wer auf diesem Flickenteppich bestehen will, ist auf die Unterstützung lokaler Warlords angewiesen. Für viele dieser Provinzfürsten ist die Beschreibung »zwielichtig« noch sehr freundlich. Sie erhalten Millionen Euro »Entwicklungshilfe«. Im Gegenzug sorgen sie kurzfristig für Ruhe in der Provinz. Zumindest, solange Drogenhändler oder Taliban nicht mehr Geld bieten. Das andere Hauptproblem sieht Schraven in der Etikettierung des Krieges. Der Bundestag verkauft den Einsatz als Friedensmission, die Soldaten als Brunnen- und Straßenbauer. »Niemand (sagt) klar und deutlich, dass deutsche Soldaten in Afghanistan kämpfen müssen … Mit Gewehren, mit Bomben und Toten«. So schwankt die Bundeswehr vor Ort zwischen widersprüchlichen Rollen hin und her. Die Tragik liegt am Ende darin, dass man in Afghanistan nicht bleiben kann. Man kann aber auch nicht gehen. | JUK
David Schraven/Vincent Burmeister: »Kriegszeiten«, Carlsen Verlag, Hamburg 2013, 120 S., 16,90 Euro
Frankfurter Buchmesse, 9. bis 13. Oktober 2013. http://www.buchmesse.de