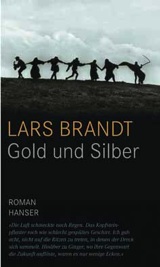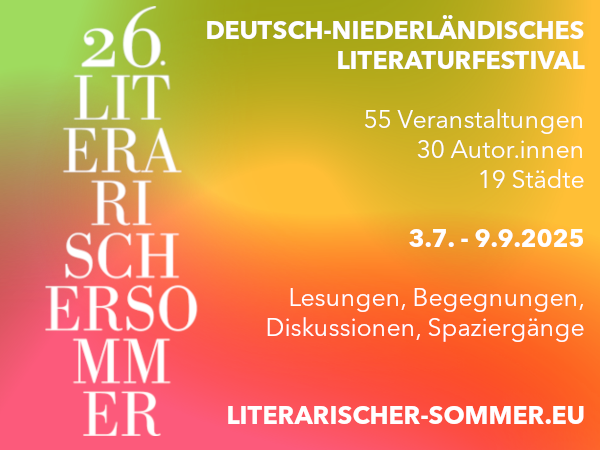Manchmal reicht ja schon ein bisschen Wein beim Portugiesen um die Ecke für eine anständige Bewusstseinserweiterung. Dort treffen sich in Lars Brandts Roman »Gold und Silber« Paavo, Jarl, Ginger, Mayo, Hans, Sebastian, Rudi, der Erzähler und noch ein paar andere, denen die Kunst nicht Ambition, sondern das Leben ist. Sie trinken, mehr noch aber reden sie. Denn um einen Fuß in die Tür nicht nur der künstlichen, sondern auch der künstlerischen Paradiese zu bekommen, braucht es eben nicht nur hochgeistige Getränke, sondern auch hochgespannte Gespräche. Also kritisiert man die letzte Ausstellung, diskutiert, ob Filme, die es zu machen lohnt, Pausen organisieren sollten, fragt sich, ob Hass eine zugespitzte Form der Objektivität ist, oder malt einfach nur einen masturbierenden Batman auf den Bierdeckel. Irgendwann geht es dann mit Saxofon, Salami und Grappa in den Wald, wo plötzlich alles zu Schweben beginnt.
Es ist eine Balanceakt, den Lars Brandt, der vor zwei Jahren mit »Andenken« ein anrührend intimes und zugleich schonungslos distanziertes Buch über seinen Vater Willy Brandt vorgelegt hat, seinen Ich-Erzähler vollführen lässt. Nicht allein, weil, wie zu fortgeschrittener Stunde am portugiesischen Stammtisch verkündet wird, der Artist zum Kunststück geboren werde und der Absturz vom Seil deshalb Gesetz sei. Mehr noch ist diese Geschichte eine mutige Gradwanderung, weil sie von der erhabenen Intensität eines Fühlens handelt, das sich über Nacht der alles entzaubernden Ironie entledigt hat. Unvermittelt bricht hier eine Zeit an, in der es dem Erzähler gelingt, nicht mehr neben sich zu stehen, dafür aber auf Distanz zu gehen zur bourgeoisen, als beengend empfundenen Wirklichkeit. Während sich das Leben mitten im Herbst nach Sommer anfühlt, gibt sich Rudi dem Rausch der Ernsthaftigkeit hin.
Es ist die Zeit irgendwann in den 1990ern. Der Fortzug aus der »kleinen Stadt« am großen Fluss, die sich unschwer als Bonn erkennen lässt, aber nie beim Namen genannt wird, hat gerade begonnen. Während auch hier die Künstlerszene zunehmend in den kreativen Bann Berlins gerät, harrt der Erzähler aus, wohl wissend, dass die Stadt für das, was er und die anderen gerade zusammen erleben, eigentlich zu klein ist. Was den Mittdreißiger hält, ist nicht nur die Anziehungskraft dieser Gruppe von bildenden Künstlern, Filmemachern, Literaten und Fotografen, die sich mehr oder weniger an einem Leben ohne Selbstentfremdung versuchen. Mehr noch ist es aber die Gingers, die, so Rudi, nicht hübsch ist, sondern schön. Sie ist es, von der er sich das richtige Lieben im falschen erhofft, ein Realmärchen, »das die eigentliche Wahrheit hinter der schäbigen Kulisse bildet, durch die wir uns bewegen.« Das Problem aber ist, dass Ginger sich dort schon mit einem anderen eingerichtet hat.
Durch diese unglückliche Liebesgeschichte im Künstlerroman schafft Brandt das dramaturgische Gegengewicht, damit sich der Schwindel, den die um sich selbst kreisende Gruppe erfasst hat, auch auf den Leser überträgt. Bringt der Ich-Erzähler doch im Verlauf der Geschichte zunehmend mehr als nur eine Handbreit zwischen sich und die Realität, die, zumindest was Ginger betrifft, für ihn eine ernüchternde ist. Er sieht Signale, wo keine sind, sein Deutungsfieber steigt. Zunächst organisiert er zufällige Begegnungen, wie es jeder Liebende tut, später folgt er Ginger nach Rom, beobachtet sie, stellt ihr nach, weil er meint, sie beschützen zu müssen.
Durch diese Perspektivenverschiebung löst Lars Brandt die Übergänge zwischen surrealem Traum und emotionalem Wahn langsam auf, wodurch »Gold und Silber« einen ganz eigentümlichen Sog entfaltet. Einen Sog, der kaum merklich beginnt und lange anhält, weil Brandt diesen Zustand auf raffinierte Weise in der Schwebe hält. Mag sie auch von einem zum anderen gehen, ist die Liebe eben doch kein selt-sames Spiel. Ohne Ironie betrachtet, kann sie sehr ernst werden. So wie es das Leben in diesen paar Monaten in den 1990er Jahren gewesen ist. Nur nicht so glücklich.
Lars Brandt, Gold und Silber; Carl Hanser Verlag, München 2008, 303 Seiten, 19,90 Euro