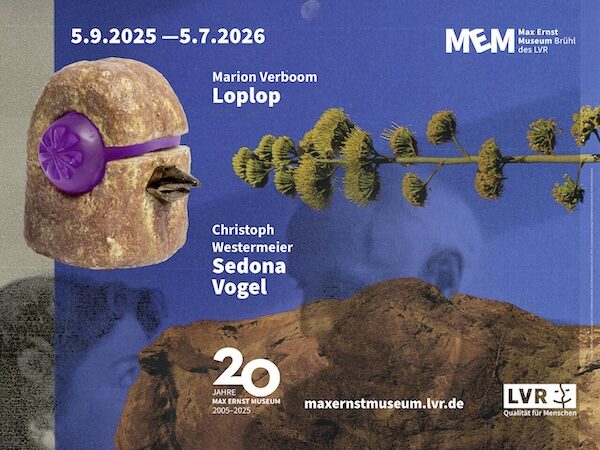Interview: Ulrich Deuter
// Es gibt zwei Festivals der Off-Bühnen mit nationaler Bedeutung: »Impulse« und »Politik im freien Theater«. Letzteres wurde 1988 gegründet und gastiert zur Feier seines 20-jährigen Bestehens zum ersten Mal in NRW, in Köln. Zwischen dem 13. und 23. November zeigt es sechs ausgewählte Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie fünf aus dem weiteren Europa; außerdem sechs Uraufführungen, die in Köln mit Kölner Gruppen entstanden sind. Zwei Geldpreise für herausragende Produktionen krönen das Programm.
K.WEST ist Medienpartner und sprach mit der Leiterin des heuer 7. Festivals, Milena Mushak, sowie dessen Kurator Rainer Hofmann. //
K.WEST: Die Bundeszentrale für politische Bildung organisiert ein Festival mit dem Namen »Politik im freien Theater«. Das ist erklärungsbedürftig.
MUSHAK: Bei seiner Gründung vor 20 Jahren war man auf der Suche nach Feldern außerhalb der klassischen politischen Bildung, auf denen das Politische stark war. Wir wollten über andere Formate diejenigen erreichen, die nicht unbedingt zu den Rezipienten und Rezipientinnen unserer damaligen Produkte zählten. So ein Feld war die freie Theaterszene, die sich damals sehr vom städtischen Theater unterschied. Was zunächst ein Experiment war, hat sich bewährt und findet seit 1993 alle drei Jahre statt. Natürlich ist die Lage heute eine andere: Für viele junge Leute ist Politik erst mal unattraktiv. Nichtsdestotrotz finden sie Musikbands, die politische Texte singen, spannend. Da klafft also eine Lücke. Die interessiert uns.
K.WEST: Was kann es heutzutage heißen, politisches Theater oder politisch Theater zu machen?
HOFMANN: Politische Manifestationen während der Theatervorstellung wie vor 40 Jahren gibt es sicher heute nicht mehr. Die Verhältnisse sind komplizierter, damit setzt sich das Theater auseinander. Unser Festival zeigt keine Stücke, die eine politische Situation einfach abbilden oder dem Zuschauer eine bestimmte Sichtweise oder politische Meinung nahe legen.
MUSHAK: Das Publikum insgesamt ist aktiver und mündiger. Das spiegelt sich auch im Theater wider: Zuschauer sind nicht mehr nur Zuschauer, sondern machen etwas mit Schauspielern, gehen mit ihnen durch die Stadt, sind Akteure, tragen ihren Teil bei. Produktionen, die keine Fragestellung offenlassen, sind für uns politisch uninteressant. Wir wollen, dass ein Denkprozess in Bewegung gesetzt und nicht, dass eine Antwort gegeben wird.
HOFMANN: Wir zeigen keine Produktionen, die rein Privates behandeln wie Beziehungsdramen. Denn dass auch das Private politisch sei, ist eine zu einfache Formel, daran mag ich nicht mehr glauben. Aber partizipative Formate und Produktionen mit »Experten« oder »Komplizen«, wie die Theatermacher das nennen, sind ein starker Bestandteil des Festivals: »Made in Köln« zeigt fünf Uraufführungen, die sich mit der Stadt auseinandersetzen und in denen Menschen aus der Stadt mitspielen.
K.WEST: Die Grenzen zwischen dem freien und dem etablierten Theater sind dramatisch geschwunden, ästhetisch wie personell. Wieso braucht man da noch Festivals wie dieses, die die überwundene Trennung wieder verfestigen?
HOFMANN: Ich glaube, dass nach wie vor im freien Theater die Produktionsweisen, aber auch die ästhetischen Formen eigene sind. Kooperationen zwischen Stadttheater und freiem Theater existieren, sind aber die Ausnahme. Und im Stadttheater sind 90 Prozent literarische Projekte, mit gutem Grund. Insofern ist es immer noch wichtig, ein Festival fürs freie Theater zu machen und dabei den Aspekt auf politische Projekte zu legen. Gleichzeitig wollen wir nicht nur Gastspiele zeigen, sondern arbeiten auch mit Kölner Gruppen zusammen – »Drama Köln«, Hofmann & Lindholm, Lukas Matthaei.
K.WEST: Kommen wir zum Leitmotiv dieses Festivals: »Echt!«. Das ist ja zunächst mal das Gegenteil von Kunst.
HOFMANN: »Echt!« meint die Auseinandersetzung mit der Realität, mit dem Verhältnis zwischen dem außerhalb des Theaters Vorgefundenen und dem Inszenierten, zwischen Fakten und Fiktivem. Das ist eine Urfrage des Theaters. Wenn man
z. B. »Matthaei & Konsorten« nimmt, die viele Wochen in Köln recherchieren und daraus ein Stadtporträt in Form eines theatralischen Stadtspaziergangs erstellen, dann werden in dieser Produktion mit dem Namen »Kurz nachdem ich tot war« natürlich sehr viele Dinge aufgenommen, die in der Geschichte und Architektur der Stadt Köln zu finden sind. Aber die werden nicht eins zu eins abgebildet. Sondern es werden Differenzen dazu gesucht, Alternativen aufgezeigt. Es tauchen »normale« Menschen auf, aber auch Schauspieler, so dass sich die Frage stellt, was echt ist, was erfunden. Und welche wahre, welche Lügengeschichte über Köln erzählt wird.
K.WEST: Sie haben Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen, also einen guten Überblick über die deutschsprachige Szene gewonnen. Wer traf die Auswahl? Und wo steht das freie Theater in diesen drei klassischen Theaterländern?
HOFMANN: Die Auswahl traf ich als Kurator in Absprache mit der Festivalleiterin Milena Mushak und in Zusammenarbeit mit einem Korrespondententeam von sechs Fachleuten. Wir haben über 350 Stücke aus einem Zeitraum von zirka drei Jahren gesichtet. Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist die Szene mittlerweile besser vernetzt über die großen Koproduktionsstätten wie Hebbel am Ufer und Sophiensaele in Berlin, Gessner-allee in Zürich usw. Das bietet den Künstlern größere Auftrittsmöglichkeiten. Die Professionalisierung hat zugenommen, aber es hat sich auch ein Zweiklassensystem verfestigt: Die einen schaffen es in diese Koproduktionszirkel und besitzen dadurch mehr Mittel und vor allem Aufmerksamkeit; die andern bleiben draußen. Das gilt nicht nur für bestimmte Gruppen, sondern auch für bestimmte Ästhetiken. Andererseits muss man sagen: Es wird zu viel produziert. Manche Häuser gleichen Durchlauferhitzern. Manchmal wäre es besser, weniger zu fördern, und dafür das Wenige stärker.
K.WEST: Wie gute Eltern lieben Festivalleiter alle ihre Kinder. Aber sie sollten auch ihr Publikum lieben, das hoffentlich nicht ausschließlich in Köln lebt und daher nicht alles angucken kann. Was also empfehlen Sie jemandem, der von auswärts kommt?
HOFMANN: Wenn ich schon gezwungen werde, dann empfehle ich »A Terrible Beauty is Born« aus Indien, ein hochintelligentes, sehr minimalistisches Monologstück mit einem großartigen Schauspieler, dem es gelingt, auf dieselbe Geschichte eine westliche und eine indische Perspektive zu werfen. Oder »Montana« vom International Institute for Political Murder, ein komplexes Drama mit großartigen Situationen, das eine Gesellschaft am Ende ihrer ökonomischen und moralischen Entwicklung beschreibt. Von den Kölner Produktionen empfehle ich »RockPlastik XXL«, das sich mit Frauen und mit Rockmusik beschäftigt, die Gruppe »One Hit Wonder« ist dazu wochenlang in der Musikstadt Köln unterwegs und macht Aktionen. In der Aufführung am 23. November sehen wir eine Dokumentation davon inklusive Rockkonzert. Eine soziale Plastik mit Rock.
MUSHAK: Es ist wirklich gemein, Tipps abgeben zu müssen – aber gut, ich mache mich stark für »Die schwarze Kammer« aus der Schweiz: Ein junger Mann kommt nachts von der Straße ab und in einem alten Haus unter, von dem die Geschichte Besitz ergriffen hat, in dem sich unterschiedliche Bürgerkriegsszenarien wiederholen. Das Stück ist eine Art Geisteroper, zwar sehr komplex, aber von einer solchen theatralischen Wucht, dass ich es unvergesslich finde. Und dann: Mich lässt »Kamp« nicht los, das in einem Modellbau des Konzentrationslagers Auschwitz spielt und mit Tausenden kleiner Figürchen einen »normalen« Tag im Lager nachstellt – wie da mittels der Figuren das Grauen noch einmal auf ganz andere Weise nahe rückt, das hat mich tief berührt.
VVK, Programm, Rahmenprogramm und Veranstaltungsorte unter www.bpb.de/politikimfreientheater