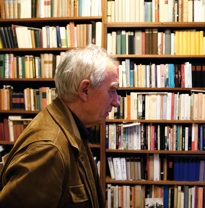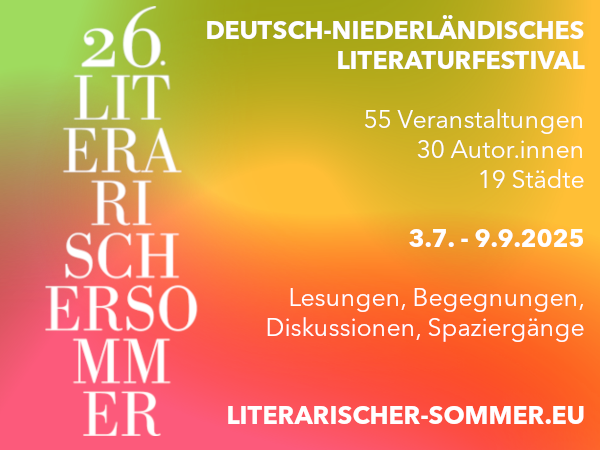Solche Besuche haben ja immer mindestens zwei Seiten. In diesem Fall sind es fünf, von denen vier hier stehen. Das ist das Eine. Das Andere wäre das Unaufgeschriebene, all das, was der Befragte wohl in der Zeit denkt, in der er eines jener ungezählten Interviews gibt, die in diesen Wochen vor seinem 80. Geburtstag absolviert werden müssen. Über sein Buch »Das normale Leben« spricht, das im August erschienen ist, über den nahenden großen Festtag, das Leben im Allgemeinen und seines im Besonderen.
Dieter Wellershoff tut dies auch in diesen Tagen, an denen es nicht leicht ist, mit ihm einen Termin auszumachen, mit interessierter Bereitwilligkeit. Erst vor kurzem ist er von einer kleinen Lesereise zurückgekommen, Berlin, Friedrichshafen, Bad Herrenalb. Heute Vormittag war schon der WDR da. Jetzt ist Wellershoff noch immer oder schon wieder sehr aufgeräumter Stimmung und ganz bei sich selbst. Natürlich in gespannter Erwartung auf die Aufnahme des neuen Erzählbandes.
Denn Besprechungen sind bisher kaum erschienen. Ein bisschen besorgt ist er, ob der Verlag wohl genügend Exemplare bereithält, wenn Anfang November die Rezensenten in den Chor derer einstimmen, die pünktlich zu den Feierlichkeiten ihr Geburtstagsständchen singen. Doch alles in allem wirkt Dieter Wellershoff – zumindest äußerlich – sehr gelassen.
Die andere, hier fehlende Seite wird wohl niemals geschrieben werden. Zum Glück – für den Besucher. Wie das nämlich gehen könnte, lässt sich in der Titelerzählung aus »Das normale Leben« nachlesen, in der dem Leser wieder einmal eine jener nur auf den ersten Blick wohlig bürgerlich aufgestellten Figuren begegnet. Alwin, ein pensionierter Rundfunkredakteur, der vor großen Auditorien über den Unterschied von »Glück haben« und »glücklich sein« spricht, erinnert sich darin an einen jüngeren Mann namens Stefan Ketteler. Der ist einige Zeit nach dem Interview den selbst gewählten Kältetod gestorben, hat sich einfach in den Wald gelegt und vom Schnee begraben lassen. »Wieder sah er den ungebetenen Gast, einen mageren, hoch aufgeschossenen Mann, der ihm vor anderthalb Jahren ein überflüssiges, nirgendwo veröffentlichtes Interview abgetrotzt hatte.« Dieser gehemmt und verspannt wirkende Stefan Ketteler hatte, nachdem alle vorformulierten Fragen abgearbeitet waren, Alwin damals dann noch als letztes die »einzige und eigentliche Frage« gestellt: »Wie kann man leben, wenn man, wie Sie, an nichts glaubt?« Keine so schlechte Frage eigentlich. Dieter Wellershoff wird sie wohl schon zig Mal beantwortet haben. Denn auf dem metaphysisch ausgelaugten, für Identitäts- und sonstige Krisen besonders fruchtbaren Boden stolpern die Wellershoffschen Figuren bis heute in ihre großen und kleinen, manchmal tödlichen Krisen hinein. Es ist ein sehr tief wurzelnder Skeptizismus, über den zu sprechen der Ältere in »Das normale Leben« sich widerwillig zeigt, weil er darin den Versuch ausmacht, ihn in »eine dieser typisch jugendlichen Lebensdiskussionen zu verwickeln«. So entfalten sich die zwischenmenschlichen Kleintragödien mit nüchterner Akkuratesse vor einem Hintergrund, den das große Ganze nicht mehr zusammenhält.
»Sinn ist das stärkste Rauschmittel, Millionen sind daran gestorben. Doch eine grundlegende Entziehungskur reicht fürs Leben.« Diese Sätze finden sich in dem autobiographischen Text »Deutschland – ein Schwebezustand «, 1978/79 geschrieben. Und das ist auch heute noch, so bestätigt Wellershoff, die »Grunderfahrung«.
Spät erst, Ende der 70er Jahre beginnend, hat Wellershoff, 1925 in Neuss geboren, seine Kriegserlebnisse literarisch aufgearbeitet. Lange waren sie ihm »ein wüstes Flackern untilgbarer Bilder«, wie er 1974 im Nachwort zu »Doppelt belichtetes Seestück« schreibt.Erst 1995 hat er seine »Innenansichten des Krieges« unter dem Titel »Der Ernstfall« vorgelegt – als moralisch weitgehend ausgenüchterten Bericht, was manchen Leser irritierte.
Für sein Leben und Schreiben ist das Sinn- Entwöhnungsprogramm »Krieg«, in dem er 1944 verletzt wird und in Gefangenschaft gerät, aber von Anfang an wegweisend. »Damals mischte sich das Gefühl, dass es keine Zukunft gibt, mit der Euphorie, zufällig überlebt zu haben, trotz Verwundung unbeschädigt. Das war wie eine zweite Geburt.« Dieter Wellershoff geht also daran, sich zunächst neu zu erfinden, arbeitet für kurze Zeit als Dachdecker, macht das Abitur nach, studiert ab 1947 in Bonn Germanistik, Kunstgeschichte und Psychologie, dabei nicht der Gesellschaft, sondern allein seinen Interessen verpflichtet.
Er promoviert über Gottfried Benn, der in dem »jungen Mann» aus Bonn früh einen »klugen Kopf» erkennt. Den bewegt seit dem Kriegsende die Frage nach einem angemessenen Kontingenzmanagement und kommt, existenzialphilosophisch geschult, zu einem zugleich einfachen und schwierigen Schluss: »Nimm diese Chance wahr! Schaff’ Dir Deine eigene Bedeutung und Notwendigkeit!« Für Menschen, die einen starken Lebensimpuls haben, sei diese Einsicht unglaublich stimulierend gewesen, sagt Wellershoff und fügt, nachdem er ein bisschen über die Durchrelativierung menschlicher Ordnungen gesprochen hat, noch hinzu: »Das Einzige, was existiert, ist die Glückssuche der individuellen Person.« Wie nur wenigen ist es Dieter Wellershoff dann in seinem Werk gelungen, die theoretisch hoch gespannte Abstraktionskraft des – in diesem Jahr mit dem Ernst-Robert- Curtius-Preis für Essayistik ausgezeichneten – Theoretikers mit einer hoch sensiblen, stilistisch überaus klar artikulierten Beobachtungsgabe zusammenzuspannen. Denn Halt und Interesse findet er im: Leben – was für ein Wort. Klingt für zeitgenössische Ohren erst einmal zu groß, sehr pathetisch, nicht leicht zu begreifen. Ein kaum zu füllendes Etwas, dessen weniger attraktive Seite »Alltag « heißt. Doch wofür sonst lohnte es sich, seine Zeit dranzugeben? Zu fassen bekommt dieses »Leben« nur, wer es im Kleinen sucht.
Das lässt sich immer wieder aus den Texten Wellershoffs lernen. Dafür hat er in den 60er Jahren literaturtheoretisch weit ausgeholt, den Anthropologen Arnold Gehlen als Gewährsmann bemüht genauso wie die französischen »nouveaux romanciers«, allen voran Alain Robbe-Grillet, den Musterschüler der »école du regard«. In die »Schule des Sehens« möchte Wellershoff dann auch Leser und Autoren schicken, wenn er 1967 einen »Wirklichkeitsschwund « diagnostiziert, weil die Realität unter Routinen und »schablonenhafter Informiertheit« verschwindet. Und setzt dem das von seinen Kritikern oft zu einfach und schnell verstandene realistische Schreiben entgegen als Versuch, »der Welt ihre konventionelle Bekanntheit zu nehmen und etwas von ihrer ursprünglichen Fremdheit und Dichte zurückzugewinnen, den Wirklichkeitsdruck wieder zu verstärken, anstatt von ihm zu entlasten.«
Als Vordenker und Vertreter der »Kölner Schule des Neuen Realismus« ist er dann selbst in die Geschichte der Nachkriegsliteratur eingegangen, unter der nun so unterschiedliche Autoren wie die von ihm in seiner Zeit als Lektor bei Kiepenheuer und Witsch geförderten Rolf Dieter Brinkmann, Nicolas Born oder Günter Herburger zusammengefasst werden. Hin also zur sinnlichen Konkretheit sollte es in deren Klassenzimmer mit allen dafür in Frage kommenden literarischen Mitteln gehen, die an den Kamerabewegungen des Films zu schärfen er immer wieder einforderte. So sollte in den Blick kommen, was der »Buntdruck der Reklame« verleugnet, die ungenutzten Kapazitäten des Menschen – und »der Spielraum möglicher Veränderung« offen gehalten werden. »Irritation ist das Bewegungszentrum der Literatur.Sie ist eine Gegeninstitution, die Komplexität wieder herstellt.« So bringt es Dieter Wellershoff an diesem Nachmittag auf den Begriff, und so ist es immer gewesen in seinen Büchern.
Mal als radikaler Ausnahmezustand, wie in »Schattengrenze« (1969), aber auch in Form von subtilsten Erschütterungen, die sich zumeist in den Erzählungen und Novellen ausgestaltet finden. Wer also immer große Verwerfungen erwartet, wird nicht selten enttäuscht. Oft reicht schon das zu lange ausphantasierte Aufscheinen einer Möglichkeit, um eine bürgerliche Existenz aus der Bahn zu werfen. Zumindest zeitweise. Denn fast immer findet sich die Ordnung am Ende wieder hergestellt – auf einer höheren Stufe. Doch möchte Wellershoff seine Schlüsse nicht als Lösungen verstanden wissen. Offene Schlüsse sind es. Denn: »In der Sicherheit, die am Ende wieder hergestellt wird, ist ein Verlust enthalten.« Man könnte diese regelmäßigen Verluste auch Konzessionsentscheidungen mit therapeutischer Wirkung nennen. Sie sind der nicht selten sehr hohe Preis, den das Leben dafür einfordert, dass es sich seiner »konventionellen Bekanntheit« entledigt. Auch sind sie Gewähr dafür, dass Literatur, die Wellershoff selbst einst als »Simulationsraum« beschrieb, eine Gefahr bannende Funktion haben kann: »Ohne eigene Lebenserfahrungen hätte ich, was ich geschrieben habe, nicht schreiben können. Dass das nicht hier und da ruinös ausgefranst ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich mich ihnen nochmals schreibend zugewandt und sie durchgearbeitet habe.« Der Leser aber bleibt an Illusionen ärmer zurück – doch reicher an Erkenntnis.
Wenn das Leben tatsächlich ein einziger Desillusionsroman ist, wie Dieter Wellershoff auch jetzt wieder bestätigt, und er das eher nüchtern und als Chance verstanden wissen möchte, dann sind seine Bücher dafür die richtigen Interpretationshilfen. Sie sind meist beredter als lange Erklärungen. Weshalb, auf die Frage, ob sich sein Umgang mit dem für sein Schreiben so wichtigen Sterblichkeitswissen im Laufe der Jahre verändert habe, er nun ein Gedicht zu zitieren beginnt, das er vor vierzehn Jahren geschrieben hat. Es heißt »Vorausgeschauter Rückblick« und lautet:
»Ich werde gestorben sein« / eine schwierige grammatische Form / neben einfachen Sätzen wie / »er ist gestorben«, »er ist tot«. / Als könnte ich auf mich zurückblicken / von dort, wo ich nie hingelange, / richtet mir die Sprache eine / unmögliche Zukunft ein: / Ich: Jemand, der weiß, / daß er jemand ist, / der jemand sein wird, / der gewesen ist, der war.
»Das, sagt Dieter Wellershoff, ist meine Grundhaltung dazu.« Jetzt wäre es dann auch langsam Zeit für die »einzige und eigentliche Frage«, die an diesem Nachmittag natürlich nicht, im Verlauf der Erzählung dann aber doch beantwortet wird. Sehr konkret sogar und dabei so ambivalent, wie es nur die Literatur zu leisten vermag. Weshalb ihr Schluss als einziger hier zitiert werden soll: »Er war ein alter Mann, der auf Abruf lebte, versehen mit der Weisung, noch einmal und solange es ging in sein normales Leben zurückzukehren. Wie auch immer es lief: Er hatte Grund, das zu feiern.« Nur sollte man Dieter Wellershoff jetzt nicht mit diesem alten Mann verwechseln. Schließlich stehen ihm um den 3. November Tage bevor, die genau das nicht sind: das normale Leben. Gründe zu feiern hat er dennoch viele. Ob nun seinen 80. Geburtstag, das Leben im Allgemeinen oder seines im Besonderen. Oder ganz einfach sein großes Werk. Soweit es jetzt schon vorliegt. //