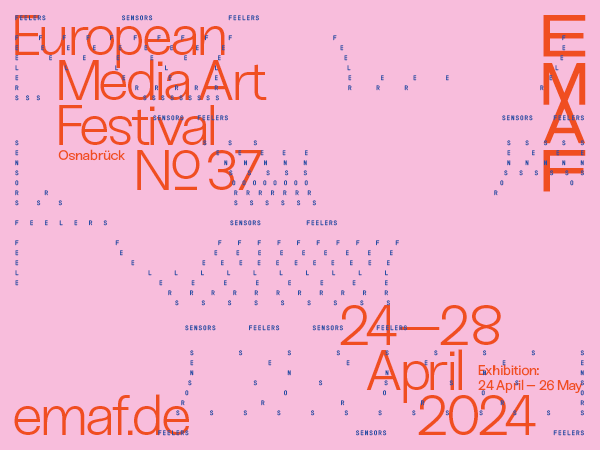TEXT: NICOLE STRECKER
Schon wieder verliebt, es geht wohl nicht anders. Erst in Véronique Doisneau, die Ballerina der Pariser Oper, dann in einen thailändischen Khon-Tänzer. Es folgten Popsong-begeisterte Laientänzer aller Alters- und Gewichtsklassen als stürmische Charmeure, und zwischendurch natürlich auch Jérôme Bel selbst, der begnadete Fragensteller, der im inszenierten Dialog mit einem seiner Performer auch schon mal klarmacht, dass dessen Kultur und Tanz absolut unbegreiflich sind.
Jede Show von Bel ist ein Herzensbrecher, egal, ob er einzelne Personen tanzredend porträtiert oder ganze Laien-Ensembles. Und obwohl seine so kühl-kalkuliert eingesetzten psychologischen Kniffe völlig durchschaubar sind, man erliegt ihnen. Vor lauter Gemütserhitzung liebt man in diesem Philanthropen-Theater sogar sich selbst ein bisschen mehr.
Seit mittlerweile 20 Jahren interessiert sich Jérôme Bel für den Menschen hinter dem Performer. In dieser Zeit hat er ein schmales Œuvre von 17 Stücken erarbeitet – nein, eigentlich sind es nur 15 Stücke, von zweien distanziert er sich heute. So überlässt er etwa die Autorschaft über die Performance »Lutz Förster« dem offenbar kaum vom Choreografen beeinflussbaren Titelhelden und Pina-Bausch-Star.
Aber für die anderen 15 gilt: Sie zählen zum Besten, was der sogenannte »Konzepttanz« hergibt. Witzig, verblüffend einfach, aber hochintelligent, immer polarisierend. Wer nach Bel noch glaubt, Konzepttanz sei »Non-Danse«, war wohl seit jeher ein Eckensteher des Dancefloor. Auf seiner Bühne wird gerockt, gehottet und geschwoft, kaum mal formvollendet, immer mit vollem Einsatz.
»Ich heiße Pichet Klunchun«, sagt Pichet Klunchun auf Jérôme Bels Bühne, ehe er sich mit wundersamer Körperbeherrschung in die Figur des Dämons aus dem traditionell-thailändischen Khon-Tanz verwandelt und auf Bitte des ebenfalls anwesenden Choreografen auch schon mal den Affen macht.
Andere Theater und freie Gruppen halten es noch nicht einmal für nötig, die mitwirkenden Tänzer auf den Programmheft- oder Werbefotos mit Namen auszuweisen, eine nicht zu begreifende Respektlosigkeit gegenüber den Performern, die längst nicht mehr nur Werkzeug eines genialen Choreografen, sondern kreative Ko-Autoren sind. Bei Jérôme Bel dagegen ist in der Regel schnell klar, mit wem man es nun die nächsten 90 oder mehr Minuten zu tun bekommt. Name, Alter, Beruf, manchmal auch Beziehungsstatus und Kinderzahl werden abgefragt. Theater als »social networking« zwischen Performern und Publikum. Und zwar ein Netzwerk, das sich inzwischen tatsächlich – Deleuze/Guattari seien gegrüßt – »rhizomartig« verbreitet. Nicht nur, weil der in der poststrukturalistischen Theorieschule sozialisierte Theatermann Bel mit seinen bestehenden Produktionen weltweit tourt. Sondern auch, weil er derzeit dabei ist, seine Kunst zur seriellen »mission culturelle« auszubauen.
Global verbreitet, lokal verwurzelt, zum Beispiel: Düsseldorf. Vor einem Jahr hieß es, Tänzer der Region, eilt herbei für das Bel-Kultstück »The Show must go on«. Jetzt heißt es wieder: Tänzer kommt für das nächste potentielle Kult-Ereignis »Gala«. In Brüssel und Berlin hat Bel bereits seine »Galas« zelebriert. Jetzt bekommt auch NRW seinen »Festakt der Durchschnittlichkeit«. Die beteiligten rund 20 Performer werden aus der jeweiligen Region gecastet und müssen ein gewisses Typen-Spek-trum abdecken. Kinder sind dabei und Alte, ein Rollstuhlfahrer, ein Jongleur, professionelle Tänzer und Schauspieler, verschiedene Hautfarben, was auf diverse Ethnien schließen lässt.
In »Gala« werden sie im Tanzhaus NRW Wiener Walzer tanzen, den Moonwalk, auch klassische Formen. Im Internet findet sich ein kurzer Clip zum Stück. Darin präsentiert jeder Performer aus früheren »Gala«-Versionen seine persönliche Idee einer Ballett-Pirouette. Verwackelt, virtuos, mit lustlos schlenkernden Armen, sturzgefährdender Energie.
Bel ist der neue Beuys, für den jeder ein Künstler war, und der das tanzhistorisch-aristokratische Konzept von der Virtuosität durch Demokratie ersetzen möchte. »Was ist es, das uns tanzen lässt?«, fragt Bel die romantischste aller Sparten-Urfragen, die schon impliziert, dass Tanzen und Menschsein quasi synonym sind. Und weiter: »Wie können wir einem Tanz zuschauen, der vielleicht verletzlich und unsicher ist, ohne mit Begriffen wie gut oder schlecht zu urteilen?«
Das ist natürlich suggestiv, schließlich hat Bel längst bewiesen, dass er weiß, wie konventionelle Kategorien auszuhebeln sind. Nirgends ist ihm das intensiver und aufrüttelnder gelungen als in seinem vielfach ausgezeichneten und weitgereisten »Disabled Theatre«, einer Produktion, die er für das Züricher Theater Hora und deren Darsteller mit Behinderung erarbeitet hat. »Ich heiße Julia Häusermann«, sagt Julia Häusermann aus der Gruppe vom Theater Hora. Wenig später sagt sie: »Ich habe Down-Syndrom und mir tut es leid.« Dann weint sie, läuft weg. In diesem Moment gab es wohl kaum jemand im Publikum, dem nicht klamm in der Brust wurde. Ein Schicksal als Entertainment für uns Normale, Gesunde, Alltagstaugliche, was immer das bedeuten mag?
Soviel zum anti-illusionistischen Theater, das seit Jahr und Tag die »Krise der Repräsentation« beschwört, wahlweise mit Antonin Artaud, Michel Foucault oder Roland Barthes als intellektuellen Geburtshelfern. Vom Ex-Knacki über den Alzheimer-Patienten bis zum Ex-Neonazi wurde dem Besucher der freien Szene oder der Stadttheater nahezu jede soziologische Peergroup vorgeführt. Darsteller, die mit dem entfesselten Charme des Laienspiels überwältigen, das aber einen Großteil seiner Kraft und seines Unverstellt-Seins durch die jeweils besonders Problematik und Realität bezieht.
Immer bleibt ein Unbehagen: Wo hört das Leben auf, wo fängt die Kunst an? Wo liegt der Unterschied zwischen Person und Figur? Schwer zu enträtseln, ob Julia Häusermanns Tränen echt sind. Kurz nach ihr kommt ein anderer Performer vom Theater Hora und sagt arglos-freundlich: »Ja, sehr gutes Theater«, als wolle er den Betroffenheits-Moment der Kollegin eben als inszenierten Auftritt markieren. Es stellt sich ein merkwürdiger Effekt ein: Man solidarisiert sich mit Jérôme Bels Darstellern, während man auf den großen Zampano, Inszenator (und Manipulator?) dahinter misstrauisch blickt. Doch vermutlich ist die geschickte Lenkung von Sympathien auch nur Bels Form, überkommene Perspektiven und Hierarchien des Theaters außer Kraft zu setzen und, poststrukturalistisch gedacht, den »Tod des Autors« zu realisieren.
Eine Performance sei keine Schöpfung, hat Jérôme Bel einmal gesagt: »Eine Performance ist ein Plan, der einige Energie produziert, damit etwas anderes geschehen kann«. Energie, das meint wohl: Tanz oder eigentlich eine Körper-Eruption zu Musik, zu der sich jeder Laien- oder Profi-Performer auf Bels Bühne mindestens einmal verführen lässt und die derart lebensbejahende Lust entfacht, dass dagegen Peinlichkeiten, jede Speckfalte, krummgelenkige Beinhebung und musikalische Taktlosigkeit null und nichtig werden.
Julia Häusermann etwa verwandelt sich, wenn sie ausgeweint hat, zum Michael-Jackson-Hit »They don’t care about us« in den King of Pop, inklusive Beckenzuckungen, Griff in den Schritt und Headbanging. Ihre Wut-Performance brachte Häusermann beim Berliner Theatertreffen vor zwei Jahren den Alfred-Kerr-Darstellerpreis ein. Und man darf sich sicher sein: Auch bei der Bel-»Gala« im Tanzhaus wird der Boden beben. Denn die Kraft seiner Performances liegt letztlich darin, dass sie zweierlei sind: Plädoyer für unsere makelbehaftete Spezies – und für den Tanz.
27./28. August 2015, Tanzhaus NRW, Düsseldorf