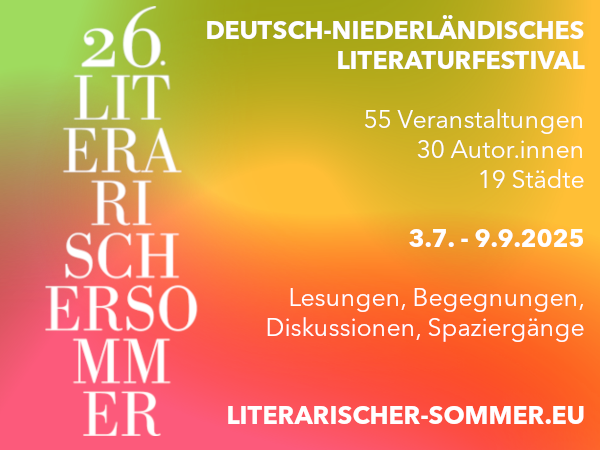40 Jahre ist es her. Jetzt endlich gibt es für jemanden den Art Cologne Preis, ohne den dieser gar nicht existieren würde. Mit seinem Kollegen Hein Stünke hatte Rudolf Zwirner das Erfolgsmodell einer Kunstmesse erfunden, indem er den Verein progressiver deutscher Kunsthändler gründete. Am 2. November wird die Ehrung Zwirner, Jahrgang 1933, einst einem der klügsten und stets strategisch denkenden Kunsthändler des Rheinlandes, während der Messe überreicht. Und da Zwirner ganz Grandseigneur und ein nobler Mann ist und auf die 10.000 Euro gewiss nicht angewiesen sein dürfte, reicht er die Summe an eine andere seiner Gründungen weiter, an das Zentralarchiv des Internationalen Kunsthandels, das heute seinen Sitz ebenfalls in Köln hat.
Auch Zwirner ist dem Ruf in die Hauptstadt – seiner Geburtsstadt – wieder gefolgt. Von seiner repräsentativen Grunewald-Villa aus kann er die rheinischen Nachbarschafts-Scharmützel aus gehöriger Distanz schmunzelnd verfolgen. Die Post geht seiner Meinung nach längst hier in Berlin ab. Die Frage, ob er nicht vielleicht doch noch als Galerist oder Kunsthändler tätig sei, beantwortet er mit entschiedenem Nein. Dazu habe er seinen Sohn David, der mit Erfolg eine Galerie in New York betreibt. Ein Kunsthändler in der Familie sei genug. Er selbst reiche sein Wissen als Honorarprofessor in Braunschweig weiter.
Zwirners beruflicher Lebensweg war von Beginn an auf höchste Qualität und exzellentes Management ausgerichtet. Zunächst Volontär in der Kölner Avantgarde-Galerie »Der Spiegel«, setzte er seine Ausbildung im Auktionshaus und in der Galerie Gerd Rosen in Berlin fort, bevor er Mitarbeiter von Heinz Berggruen wurde, dem damals größten Grafikhändler Europas, wo er die Schätze des in Paris zur Autorität gewordenen Sammlers in dessen Lager kennen lernte. 1959 betraute ihn Arnold Bode mit der organisatorischen Durchführung der documenta 2. Zwirner wurde Generalsekretär der Kasseler Weltkunstschau – und hatte dabei sein Aha-Erlebnis.
Zwirner erzählt: »Es war die Apotheose des Informel. Aber auf dem Höhepunkt kippte die Kiste, denn es wurde amerikanische Kunst eingeladen, die das Museum of Modern Art in New York selbst auswählte. Und da passierte das Unglück, dass wir vorher nicht mit dem Leihgeber MoMa über die Formate diskutiert hatten. Es hieß nur, die Meister bekommen drei Bilder, die ganz großen Meister sechs und die Ausnahme Jackson Pollock zwölf Bilder. Aber Barnett Newman brauchte für jedes seiner drei Bilder schon eine ganze Wand. Wir hatten unterm Dach Räume vorgesehen, da passte keines dieser Gemälde rein. Die Amerikaner erhielten daraufhin die Staatsräume und die Europäer zeigten ihre Werke auf dem Dachboden, bei Temperaturen von 40 Grad. Es war eine Katastrophe für die europäische Kunst. Die Amerikaner wirkten großartig in den Prachtsälen – und kosteten ein Drittel im Vergleich zu Franzosen wie Pierre Soulages.«
Er zog daraus die Konsequenz. Kurz darauf, Ende 1960, eröffnete Zwirner eine Galerie in Essen, zog 1962 nach Köln um und blieb dort 30 Jahre Galerist. Beizeiten präsentierte er mit Warhol, Lichtenstein und Rauschenberg die amerikanische Kunst der Gegenwart. Dennoch hatte auch er klein angefangen. Während der aktuellen Art Cologne wird seine erste Kölner Galerie Am Kolumbahof 2 nachgebaut, bevor das Haus abgerissen wird. Zwirner gibt zu, dass die erste Adresse vor dem Umzug auf die Albertusstraße »für heutige Begriffe ein Witz, viel zu klein, die Hälfte eines Zimmers« gewesen sei. Dort hat er bis 1967 gehandelt, »die Brillo-Boxen von Warhol, einen großen Kasten von Arman, Arbeiten von Richard Hamilton, Twombly, Richter, Klapheck angeboten. Das Büroräumchen dahinter war für das Archiv freigehalten, für Fotos, Zeitungsausschnitte etc.«
Die Anfänge sind ihm in lebhafter Erinnerung: als Zeit, in der »sich zeitgenössische Kunst sehr schwer verkaufen ließ. Der Kunsthandel war im Wesentlichen auf sogenannte »Entartete Künstler« ausgerichtet. Man kaufte Kunst, die im Dritten Reich von den Nazis diffamiert war, als Wiedergutmachung und wegen des Nachholbedarfs. Die Kunst, wie ich sie mit der Pop Art vorantrieb, hatte keinen Preis. Es gab kaum eine Galerie dafür, geschweige denn einen Käufer.« Selbst für einen Mann wie Zwirner war das Geschäft nicht einfach. Außer dem Sammler Wolfgang Hahn habe es so gut wie keine Interessenten für die Positionen der 60er Jahre gegeben. Aus diesem Dilemma heraus entstand 1966 der Verein progressiver deutscher Kunsthändler, der 1967 die erste Kunstmesse in Köln veranstaltete. Ohne eine »Lichtgestalt«, so Zwirner, wäre es nicht gegangen: den damaligen Kulturdezernenten Kurt Hackenberg. Der stellte für den ersten Kölner Kunstmarkt den Festsaal des Gürzenich äußerst preiswert zur Verfügung, behielt aber die Eintrittsgelder. Man rechnete mit 2000 Besuchern, es kamen aber 20.000. So machte jeder ein Geschäft, Stadt wie Galeristen.
Zwirner nahm sich zwei ziemlich weit voneinander entfernt scheinende Kunst-Figuren zum Vorbild: Andy Warhol und Albrecht Dürer. Der Popartist wertete den Begriff des Kunstwerks um, indem er sein Atelier in die legendäre »Factory« verwandelte und in den neuesten Siebdruckverfahren seine Kunst seriell produzieren ließ. Dürer war schon knapp 500 Jahre zuvor in Köln und Amsterdam auf dem Markt aufgetaucht, wo seine Frau die großen Holzschnitte und Kupferstiche verkaufte, während er die Bildproduktion der Konkurrenz beäugte. Zwirner: »Die Philosophie der beiden ermutigte uns, aus der auratischen Atmosphäre einer Galerie herauszugehen und einen neuen, öffentlichen Markt zu betreten.« So übernahm er im Zweigespann mit Stünke die Aufgabe des Organisators im technischen und logistischen Bereich.
Der Erfolg gab ihm recht. Zwirner: »Das Publikum strömte – aus Hamburg, München und anderen deutschen Städten. Zur allgemeinen Überraschung reisten sie aber auch aus Holland und Dänemark an, allesamt extrem neugierig, denn einen Kunstmarkt hatten sie noch nicht gesehen, und zeitgenössische Kunst auch nicht. Sie kauften und kauften und kauften. Wir boten Grafik von Warhol und Lichtenstein unter 1000 Mark. Nun stiegen die Preise rasant an. 1968 tauchte dann Peter Ludwig auf und begann mit dem Sammeln.« Wenig später brachte sich auch Düsseldorf ins Spiel, mit einem Kunstmarkt namens IKI (Internationale Kunst- und Informationsmesse) und mit der Westdeutschen Kunstmesse, die lange Zeit zwischen Düsseldorf und Köln alternierte. Zwirner gehört nicht zu je nen, die die oft vergeblichen Bemühungen der Landeshauptstadt, am Kunstmarkt teilzuhaben, ablehnen. Im Gegenteil: »Die Konkurrenz war extrem wichtig, weil die Politik nur auf solchen Druck reagiert. Wenn die Nachbarschaft etwas tut, dann geht es los. Es war ein ständiger Kampf zwischen Köln und Düsseldorf im besten Sinne.« Dass im Moment Düsseldorf die Nase im Wettstreit vorn habe, sieht auch Zwirner so. Er gibt Köln den Rat, mehr zu investieren. Zum Nulltarif lasse sich nichts bekommen. Man müsse international renommierte Kuratoren zu wichtigen Ausstellungen herbitten. Düsseldorf beschreite diesen kostspieligen Weg mit Erfolg.
Von seiner dem Alltagsgeschäft enthobenen Position vergleicht Zwirner gelassen den rheinischen und den Berliner Kunstmarkt. Die Chancen sieht er eindeutig nicht bei der alten Heimat. Ein Berliner Künstler könne für unter tausend Euro an einem zentralen Standort ein Atelier anmieten, es stimme die Relation zwischen Kreativität und Mietpreis. Außerdem gebe es den einmaligen Austausch zwischen Ost und West. Die Künstler kämen wie in den vergangenen 20er Jahren an die Spree, auch aus internationalen Metropolen, darunter überraschend viele Amerikaner und Engländer. Ein Klima von Euphorie lasse sich nun mal nicht eben umleiten. Und so prophezeit Zwirner als Kassandra, dass »in den nächsten Jahren Berlin und nicht mehr das Rheinland der wichtigste Standort für die Kunst« sein werde. Es sei wie in der Physik: »Ist eine bestimmte Masse da, zieht es weitere Massen an.« Köln wird es nicht gern hören. Die Trophäe ist Zwirner dennoch – verdient – sicher.
»Um 67. Rudolf Zwirner und die frühen Jahre des Kunstmarkts Köln«, kuratiert von Brigitte Jacobs van Renswou und Günter Herzog, Leiter des Zentralarchivs des internationalen Kunsthandels ZADIK; eingerichtet in den alten Galerieräumen am Kolumbahof mit Leihgaben aus der Sammlung Ludwig, die von Peter Ludwig durch Vermittlung von Rudolf Zwirner angekauft wurden, sowie Bild- und Textdokumenten aus dem Archiv der Galerie Zwirner im Bestand des ZADIK; zur Ausstellung erscheint in Kooperation mit der Koelnmesse eine Sonderveröffentlichung/Festschrift in der vom ZADIK herausgegebenen Reihe »sediment«; 31.10. bis 5.11.; Kolumbahof 2, 50667 Köln, 12 bis 20 Uhr; Lange Nacht der Kölner Museen: 4./5.11., 19 bis 3 Uhr.