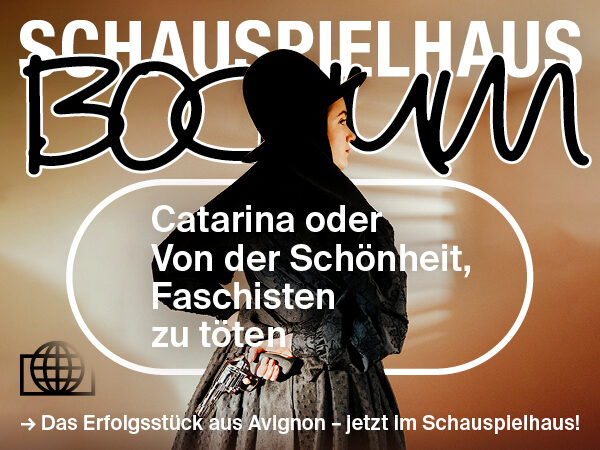Wer in Nordrhein-Westfalen die Milchstraße sehen will, hat vor allem in den großen Städten äußerst schlechte Karten. In Höxter sieht es schon besser aus, die Eifel ist sogar Sternenpark. Langsam aber sicher wird Lichtverschmutzung im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Thema.
Bisher ist noch nichts von einer Massenbewegung der Sterngucker von Gelsenkirchen nach Höxter bekannt. Aber eigentlich wäre das eine gute Idee: Gelsenkirchen zählt zusammen mit Düsseldorf zu den Orten in Nordrhein-Westfalen, wo die Lichtverschmutzung am stärksten ist. Im Kreis Höxter ist sie dagegen mit Abstand am niedrigsten. Hier – und im südlichsten Zipfel des Bundeslandes, im Nationalpark Eifel, die mittlerweile sogar »Internationaler Sternenpark« ist, ist in manchen Nächten noch ein ungetrübter Blick auf die Milchstraße möglich. Der ist ein guter Indikator dafür, wo zu viel Licht in den Himmel abgestrahlt wird.
Um herauszufinden, was Lichtverschmutzung überhaupt ist, spricht man am besten mit Christopher Kyba. Der Wissenschaftler, der zuletzt am Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum gewirkt hat und sich jetzt um eine Heisenberg-Professur zur Lichtverschmutzung bewirbt, hat sich jahrelang in das Thema hineingearbeitet. 2023 bekam er den mit 20.000 Euro dotierten Forschungspreis für Citizen Science »Wissen der Vielen« verliehen, weil er es tatsächlich geschafft hatte, mithilfe von Nachthimmel-Beobachtungen von Bürger*innen belastbare Daten zu bekommen. Ihre Beobachtungen, bei denen sie genau angeben sollten, welche Sterne sie wann sehen konnten, sind eine sinnvolle Ergänzung zu den Daten der Satelliten, die unseren Bereich der Erde immer nur um zwei Uhr nachts vom All aus beobachten. Aber vielleicht ist es um zwölf oder ein Uhr noch viel heller – aber schon genauso schädlich für Tiere und Umwelt?
Ein Licht muss nicht blenden
Aber fangen wir vorne an: Was meint Lichtverschmutzung überhaupt? »Erstmal ist das ein großer Sammelbegriff«, erklärt Christopher Kyba mit feinem englischem Akzent. »Wenn Licht von meinem Nachbarn durch mein Schlaffenster scheint und mich stört, dann nervt das, ist aber noch keine Nachthimmel-Verschmutzung.« Allerdings gilt selbst das Licht des Nachbarn, wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet, als Lichtimmission. Und ob der Nachbar zum Beispiel die ganze Nacht seine Garageneinfahrt taghell erleuchten darf, ist im Bundes-Immissionsschutzgesetz geregelt. Die Nachtruhe ist in Deutschland (und anderen Ländern) also nicht nur eine Sache von Lärmbelästigung.
Eine weitere Art der Störung, die Licht verursachen kann, ist die der Blendung. »Wenn man älter wird, fängt man irgendwann an, den grauen Star zu entwickeln. Dadurch wird das Auge leichter geblendet und man sieht den Rest um den hellen Bereich herum nicht mehr so gut.« Heute macht nicht mehr unbedingt jeder Mensch diese Erfahrung – aber sie kann sehr hilfreich sein: Wenn man zum Beispiel mit dem Auto zum Campen auf eine Waldlichtung fährt und nach dem Ausschalten der Scheinwerfer nicht sofort das Handy-Licht einschaltet, wird man merken, dass die Augen sich relativ schnell an Dunkelheit anpassen. Wenn nicht gerade Neumond und komplett bewölkter Himmel ist, sieht man in der Regel ohne Taschenlampe mehr als ohne – weil das Auge dann auch die Bereiche außerhalb des hellen Lichtkegels erkennen kann.
»Ein Licht muss normalerweise nicht blenden«, sagt Christopher Kyba. »Es ist dann nicht an den Ort angepasst oder strahlt in die falsche Richtung. Ein Leben ohne Blendung wäre möglich! In Innenräumen sorgen wir normalerweise dafür, dass das so ist.«
Susanne Hüttemeister, Direktorin des Planetariums Bochum und Professorin an der Ruhr-Uni ist ihm quasi eine Verbündete in Sachen Lichtverschmutzung. Sie weiß, dass sich sowohl bei »Otto-Normal-Bürgern als auch bei vielen Lokalpolitikern« die Sichtweise durchgesetzt habe, dass mehr Licht generell mehr Sicherheit bedeute. An Angstorten wie Unterführungen, die auch tagsüber unangenehme Gefühle auslösen, mache das zwar sicher Sinn. »Aber ansonsten sagt die Polizei, dass es keinen Beweis gebe, dass mehr Beleuchtung Kriminalität verhindere. Trotzdem heißt es immer, wenn jemand über eine Wurzel stolpert: Sorgt für mehr Licht!«
»Mehr Licht« forderte angeblich Goethe auf dem Sterbebett. Aber er meinte damit wohl eher die Erkenntnis des Geistes – und die hat er wie viele Kollegen auch beim Blick in den Sternenhimmel gehabt. Novalis, Eichendorff oder Shakespeare – so viele Dichter haben Mond- und Sternennächte besungen. Die UNESCO erwägt deshalb seit Jahren die Möglichkeit, den Sternhimmel selbst unter Schutz zu stellen, als Welterbe, das jeder Mensch ein Recht hat, ihn unverstellt anzuschauen. Die knapp 270.000 Gelsenkirchener könnten dann zusammen mit den gut 610.000 Düsseldorfern eine Sammelklage einreichen und das Recht auf bezahlte Ferien in Höxter oder dem Kreis Euskirchen einfordern.
Auswirkungen auf die Natur
Ihre Forderung könnte aber auch lauten: Weniger Licht! Denn dadurch, dass das gestiegene Sicherheitsbedürfnis in der Gesellschaft mit dem Bedürfnis nach mehr Beleuchtung in der Nacht einhergeht, werden die Chancen immer größer, dass Licht in den Himmel, ins All abstrahlt. Denn das ist die eigentliche Lichtverschmutzung: Himmelshelligkeit. »Alle Lichter, die wir draußen nutzen, werden vom Boden reflektiert oder strahlen direkt in die Luft. Manches geht direkt in den Weltraum, manches wird absorbiert von der Atmosphäre und ist als Himmelshelligkeit zu sehen«, erklärt Christopher Kyba. »Das hat zur Folge, dass Astronomen und alle anderen Menschen die Sterne nicht gut sehen können.«
Die Folgen für den Menschen, dem dauerhaft die Erfahrung des nächtlichen Sternenhimmels fehlt, sind kaum erforscht. Die Himmelshelligkeit hat allerdings auch Auswirkungen auf die Natur. Darüber wissen wir mittlerweile besser Bescheid. Es gibt klare Messungen, die zeigen, dass Licht das Verhalten von Tieren verändern kann. Man braucht nur die Motten zu beobachten, die nervös wieder und wieder um die heimische Außenlaterne flattern, um zu erahnen, dass bestimmte nachtaktive Insekten von Licht geleitet werden und in ihrem genetischen Programm nur das Licht von Sternen und Planeten gespeichert haben, aber keine künstlichen Lichtquellen. Auch der Vogelzug oder das Wachstum von Pflanzen und Bakterien im Wasser werden von künstlichem Licht beeinflusst.
»Als Menschen noch keine Straßenbeleuchtung hatten, war nachts weniger los in der Stadt«, weiß der Lichtverschmutzungs-Forscher. »Die Tiere konnten diese Zeit nutzen. Bienen blieben ihrem Stock länger fern. Generell wurden Insekten nicht durch die vielen Lichtpunkte in ihrem Sicht- und Navigationssystem beeinflusst. Zugvögel fliegen oft nachts, weil die Atmosphäre stiller ist und sie die Sterne für die Navigation nutzen. Besonders beleuchtete Fassaden sind gefährlich für sie. In den USA gibt es bereits die Initiative »Lights Out«, wo zumindest während der Vogelzugzeit die Beleuchtung ausgeschaltet wird. Und viele Menschen produzieren durch das viele Licht erst später Melatonin, gehen später ins Bett. Manche sind sensibler als andere: Ich wache sogar auf, wenn der Mond auf mein Kissen scheint.«
Laternen aus!
Im Moment gibt es parallel laufende Entwicklungen: Mit der LED-Technologie wird es immer weniger energieintensiv, also auf eine Art »umweltfreundlicher«, Licht zu erzeugen. Deshalb neigen Menschen eher dazu, Lichtquellen die ganze Nacht anzuhaben. Es kostet ja nichts, verbraucht nicht viel an Ressourcen. Doch gleichzeitig kommt das Bewusstsein für Lichtverschmutzung in Teilen der Bevölkerung und zumindest auf den Entscheidungs-Ebenen mehr und mehr an. »Frankreich hat seit 2013 ein nationales Lichtverschmutzungsgesetz«, weiß Christopher Kyba. »Mittlerweile schalten Kommunen die Beleuchtung spät in der Nacht aus. Auf dem Land sind die Straßenlaternen der wichtigste Faktor für Lichtverschmutzung. Es macht einen sehr großen Unterschied, wenn sie das tun: Vom Satelliten aus sieht man, dass es nachts dort tatsächlich dunkler geworden ist.«
In Deutschland ist man von solchen radikalen Maßnahmen noch weit entfernt. Auf einer Karte des Hessischen Netzwerks gegen Lichtverschmutzung kann man sich Orte in ganz Deutschland anzeigen lassen, die nachts die Beleuchtung ausschalten: Mit dabei sind zum Beispiel Gütersloh, Düsseldorf oder Hagen. Schaut man sich die Maßnahmen genauer an, sieht man allerdings, dass nicht Lichtverschmutzung, sondern Energieeinsparung das dahinter liegende Thema ist. In Düsseldorf werden historische Gaslaternen ausgeschaltet – von 3 bis 5 Uhr nachts. Und in Gütersloh ist schon eine laute Diskussion über die neue Praxis entbrannt. An den Wochenenden soll die Beleuchtung künftig erst um 3 statt wie bisher um 2 Uhr abgeschaltet werden.
Deshalb sieht die Satellitenkarte, die nächtliche Himmelshelligkeit anzeigt, und die man zum Beispiel unter lighttrends.lightpollutionmap.info abrufen kann, in NRW immer noch überwiegend gelb (hell) bis rot (sehr hell) aus. Tiefrote Punkte sind zum Beispiel die Flughäfen in Düsseldorf und Köln-Bonn. Aber auch das neue Gewerbegebiet MARK 51°7 auf dem ehemaligen Opelgelände im Bochumer Osten lässt sich leicht ausmachen.
Planetariumsleiterin Susanne Hüttemeister, die eigentlich auch außerhalb ihres Hauses gerne auf den echten Sternenhimmel schaut, wohnt leider ganz in der Nähe: »Wir gucken genau auf das DHL-Verteilzentrum. Das ist so unglaublich hell! Auch nachts, wo wohl noch Lieferverkehr ist. Wir haben das Thema schonmal angesprochen: Warum brauchen die Lkw diese unglaublich starke, nach oben strahlende Beleuchtung, die man aus dem Weltall sieht? Planeten kann ich von meiner Terrasse aus sehen, aber die Milchstraße natürlich nicht.«
Trotzdem sehen sowohl Susanne Hüttemeister als auch Christopher Kyba positive Ansätze: »Das Bewusstsein bei Entscheidern wächst. In Bochum wird die Straßenbeleuchtung nachts zumindest gedimmt«, sagt die Professorin. In der Unteren Naturschutzbehörde Köln suchen findige Mitarbeiter nach Lösungen. In der Eifel gibt es den Sternenpark, der die nächtliche Dunkelheit aktiv schützt. Und für jeden, der selbst etwas tun will, gibt es die kostenlose Broschüre »Tipps zur Vermeidung und Verminderung störender Lichtimmissionen« vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Mit ihr kann man sich fragen: Strahlt meine Außenbeleuchtung nach oben ab – oder seitlich gegen die Nachbarn? Kann ich einen Bewegungsmelder installieren? Muss die Werbung an meinem Ladenlokal um 3 Uhr morgens eingeschaltet sein?
Auch Kirchengemeinden können überlegen: Muss unsere Kirche jede Nacht angestrahlt werden? Wird die Wahrnehmung vielleicht sogar größer, wenn ein Gebäude nicht immer beleuchtet ist? Christopher Kyba hat ein einfaches, aber schlagendes Beispiel: »Die Weihnachtsbeleuchtung wird doch dadurch schön, dass sie zeitlich begrenzt ist.«