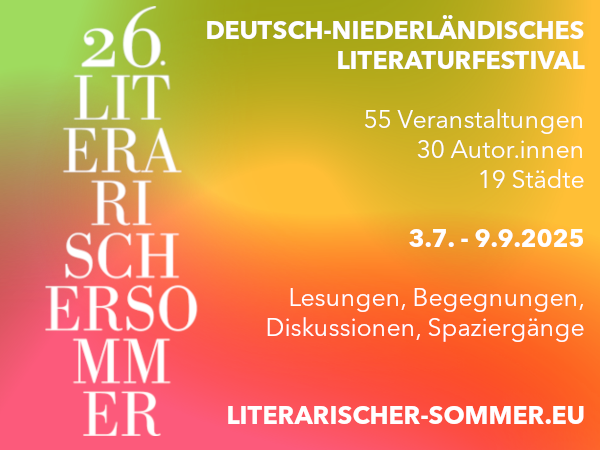TEXT: MARTIN KUHNA
»Ich bin abgerissen« – »Ich werd’ abgerissen« – »Ich werd’ nicht abgerissen«. So stellen Bruckhausener sich vor. Die Gruppe »bin abgerissen« wächst seit 2008 und soll nach dem Willen der Duisburger Stadtplaner weiter wachsen. Deren selbsterfundenes Schlüsselwort heißt »Industrienahtlage«. Im Norden der Stadt gibt es viel davon, und Bruckhausen ist ein Extremfall. Von 1889 an pflanzte August Thyssen eine Schachtanlage und ein Stahlwerk an das Rheinufer. Kurz darauf entstand unmittelbar östlich das gründerzeitliche Bruckhausen, erbaut von Bürgern, die durch Geschäfte mit Thyssen zu Geld gekommen waren.
Dabei hatte Thyssen ganz nah an der »Naht« auch noch eine Gift und Galle spuckende Kokerei gebaut. Dreck und Lärm des Werks müssen – bei vorherrschendem Westwind – infernalisch gewesen sein. Doch die Bruckhausener kokettierten stolz mit diesem Hintergrund ihres Wohlstands, der sich ausdrückte in prächtigen Häusern, Geschäften, Restaurants und Kneipen. Erst Ende der 1960er Jahre kippte die Situation. Altbauten wurden unbeliebt, der Industriedreck begann zu stören. Auch die ökonomische Symbiose mit der Hütte funktionierte nicht mehr. Viele zogen weg. Schon damals war von Abriss die Rede. Statt dessen wurde Bruckhausen zum Sinnbild des wilden Industriegebiets. Schimanski pöbelte und prügelte dort; der Tele-Blick durch die Dieselstraße auf den Hochofen vier wurde zum Klassiker und zur Ikone der Becher-Fotografie.
DER GRÜNE WALL
2003 schien sich eine Chance zu eröffnen: Der große Nachbar, jetzt unter der Firma ThyssenKrupp, schloss die nur einen Steinwurf entfernte Kokerei. Da auch andere Teile des bis heute weltweit größten »integrierten Hüttenwerks« modernisiert wurden, war die Luft im Viertel so sauber wie nie. Überdies plante ThyssenKrupp, auf dem Gelände der Kokerei einen hohen begrünten Wall zu errichten. Die Häuser gegenüber sollten restauriert werden.
Dann muss irgendetwas passiert sein. Unversehens entwickelten die Stadt Duisburg, ihre vor Ort agierende »Entwicklungsgesellschaft Duisburg« und ThyssenKrupp gemeinsam ein ganz anderes Konzept: Der grüne Wall, nur noch drei Meter hoch, soll nun nicht mehr auf Firmengelände entstehen, sondern diesseits der Straße. Und deshalb sollen über 120 Häuser verschwinden. Durch Amputation des westlichen Körperdrittels soll der Patient Bruckhausen »stabilisiert« werden. Seit 2008 sind die stadtplanerischen Chirurgen am Werk.
Eine ausführliche Sanierungs-Begründung der Stadt schildert Bruckhausen in den schwärzesten Farben. Sie steckt allerdings voller Widersprüche. Natürlich wird die »Industrienahtlage« ins Feld geführt. Nur ist dem Dokument auch zu entnehmen, dass Lärm hauptsächlich von der Straße rührt und nicht vom Thyssenwerk. Dass die Schmutzbelastung drastisch gesunken ist und im übrigen bleibende Häuser ebenso betrifft wie abzureißende. Dass Veranstaltungen im Park verboten sein werden, wegen möglicher »Störfälle« im Werk, denen indes die Bewohner benachbarter Häuser ebenso ausgesetzt wären.
Tadelnd wird vermerkt, dass es in Bruckhausen gar keine Infrastruktur mehr gebe: Geschäfte, Post, Sparkasse, Apotheke, Ärzte. Allerdings hat die Stadt vor 20 Jahren in knapp einem Kilometer Entfernung ein »Dienstleistungszentrum« errichtet, wo all das zu finden ist; nicht alle Dienstleister, so hört man, sind gern hingezogen. Städtisches Königsargument ist das ruhrtypische Phänomen der »schrumpfenden Stadt«, das hier beispielgebend angegangen werde. Allerdings ist Bruckhausen ein Stadtteil mit besonders junger Bevölkerung, und von 2001 bis Sanierungsbeginn hat es keine Abwanderung mehr gegeben. Nur sind es, da lässt das städtische Papier kaum Zweifel, die falschen Leute, die bleiben: zu ausländisch, zu arm.
ALLES NUR THYSSEN-KRUPP ZU GEFALLEN?
Bruckhausener versuchen, sich ihren Reim auf das Ganze zu machen. Markus Hagedorn – wird abgerissen – spuckt angewidert das Wort »Public Private Partnership« aus: Das alles könne eigentlich nur ThyssenKrupp zu Gefallen geschehen. Mit dieser Meinung steht der Vorsitzende des »Sanierungsbeirates« nicht allein, zumal »TK« die Hälfte der 70 Millionen Kosten übernimmt. Was TK aber von dem Kahlschlag haben sollte, darüber rätseln sie in Bruckhausen: Glacis für Werkerweiterungen, die sonst an Abstandsregeln scheitern würden? Beseitigung einer ästhetischen Zumutung für Werksbosse und ihre auswärtigen Gäste?
Hagedorns Haus, Heinrichstraße, »grüner Bereich«, steht noch, trotzig mit Geranien geschmückt. Aber flankiert von zwei Ruinen. An der nahegelegenen Ecke zur Bayreuther Straße klafft eine große Lücke: Das besonders prächtige Eckhaus stand laut Plan im »roten Bereich« und wurde doch abgerissen. Inkonsequent, unberechenbar. Vielleicht eine Gemeinheit gegen den renitenten Hagedorn; dem scheint das nicht abwegig. Sein zentraler Vorwurf an die »Haupttäter« von der Entwicklungsgesellschaft: »Wir alle haben nicht das Gefühl, dass wir Menschen sind, mit denen demokratisch umgegangen wird.«
Das sieht Mehmet Yildirim – wird nicht abgerissen – genauso. Der bürgerliche Mann – befreundet mit dem 2012 geschassten Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) – betreibt das Café »Tor 1« direkt am Werkseingang, mit werksinterner Telefonnummer für Bestellungen. Yildirim ist für den grünen Wall. Er würde gern ein Café im Park bauen und dafür sein altes Haus abreißen lassen – schließlich liegt es direkt am Werk. Nun aber soll es als Teil eines »Eingangs«-Ensembles zum verstümmelten Ortskern stehenbleiben. Versteht niemand. Die Entwicklungsgesellschaft, sagt Yildirim, habe in all den Jahren nie »etwas Nachhaltiges« geschafft für Bruckhausen, und nie seien die Bewohner beteiligt worden. »Wie in Südamerika!« sei das alles. Dagegen habe auch Freund Sauerland nichts ausrichten können.
SCHLIMMER ALS DIE MAFIA
Abdelkader Belhadj – wurde abgerissen, wird nicht abgerissen – sagt es noch drastischer: »Kennst du die marokkanische Mafia?«, fragt er, »die das ganze Haschisch nach Europa schmuggelt? Kriminelle.« Was in Bruckhausen passiert, sei schlimmer – »ich schwör’s dir!« Der ehemalige Schweißer musste aus seinem ersten Haus in der Bayreuther Straße raus; es ist abgerissen. Ein paar hundert Meter weiter wohnt er jetzt in derselben Straße. Lebt von den vermieteten Wohnungen und vom Krempelsammeln. Dauernd ist »Abdel« unterwegs im Viertel; man hört ihn oft von weither singen. Kein Hausbesitzer aus dem Bürgerbilderbuch.
Als Abdel und seine weinende Frau ihr erstes Haus verlassen mussten, war Pierre Kramann-Musculus dabei; er gehört zu einer Studentengruppe der Universität Weimar, die für ihre Abschlussarbeit mit Bewohnern Bruckhausens Planungsalternativen erarbeitet und dafür an der Bayreuther Straße ein Büro unterhält. Kalt seien die Vertreter der Entwicklungsgesellschaft gewesen, drängend, hätten dumme Witze auf Kosten der Familie gemacht. »Ich habe mich geschämt, Deutscher zu sein«, sagt Kramann-Musculus. An der städtischen Planung und den Begründungen lassen der Urbanistik-Student und seine Kommilitonen kaum ein gutes Haar. Und was die Motive für den Duisburger Abriss-Furor betrifft, kennt er viele Gerüchte, aber letztlich, sagt er, »ist man da eigentlich ratlos«.
SCHUTT UND MÜLL ÜBERALL
Nicht anders ergeht es Katrin Gems von der »Geschichtswerkstatt Duisburg-Nord«. Sie zeigt auf ausgeweidete Abbruchhäuser in städtischem Besitz – überhaupt nicht gesichert, offen für Vandalen und Diebe. In manchen dieser Häuser sei nicht einmal das Gas abgestellt worden. Sie zeigt Stellen, wo sich wochenlang Schutt- und Müllberge stapeln, ohne dass die Stadt etwas unternimmt. Und da, das Haus schräg gegenüber von Mehmet Yildirims Café: Seine Bewohner sind eines Morgens entsetzt hochgefahren; ihr Haus bebte, als ohne Vorankündigung das Gebäude nebenan abgerissen wurde. Ein Haus übrigens, das mit dem »Tor 1« doch wohl zum »Eingangs«-Ensemble hätte gehören müssen – sollte man meinen.
Irmgard Biernetzki wohnt nicht in Bruckhausen; sie arbeitet dort – seit über 20 Jahren im kleinen Lädchen »Ameely«, das nur überlebt in enger Symbiose mit Thyssen(Krupp): durch den Verkauf belegter Brötchen und Getränke an Belegschaftsmitglieder. Das Geschäft zählt zur Rubrik »wird nicht abgerissen«. Trotzdem hält Irmgard Biernetzki nichts von dem Grüngürtel. Besser werde nichts dadurch, nur schlechter. Kein Wunder: Sie schaut aus ihrem Laden auf die einst zentrale Reinerstraße, die laut Sanierungsplan am Rand noch eben im »roten Bereich« liegt und erhalten werden soll. Viele der alten Häuser aber stehen leer und wirken hoffnungslos verfallen. Fünf Jahre nach Beginn der Sanierung.
DIE MENSCHEN STOSSEN AUF GRANIT
Biernetzki hat sich an das Zusammenleben mit den vielen Ausländern in Bruckhausen gewöhnt – aber jetzt fühlt sie sich außerhalb des Lädchens nicht mehr sicher. Die vielen neuerdings einquartierten Menschen aus Rumänien und Bulgarien sind nicht nur ihr unheimlich. Solche Angst teilen Katrin Gems und Markus Hagedorn nicht, aber sie bestätigen: Seit einiger Zeit werden ausgerechnet jene Menschen in Bruckhausen angesiedelt, die von der Stadt als superschwierige Armutsflüchtlinge bezeichnet werden. Wie das zur »Stabilisierung« eines Viertels passen soll, dem die Stadt immer wieder einen problematisch hohen Ausländer- und Armenanteil bescheinigt, ist wieder so ein Bruckhausener Rätsel.
Bislang haben die protestierenden Bruckhausener bei der Stadt auf Granit gebissen, ebenso auswärtige Stadtexperten, Denkmalschützer und Politiker, die wie Ex-Minister Christoph Zöpel das Duisburger Vorgehen in Bruckhausen und anderen nördlichen Stadtteilen nicht als Zukunftsmodell sehen, sondern als Rückfall in die blinde Abrisswut der 60er und 70er Jahre. 50 Häuser sind schon verschwunden. Weitere 70 sollen folgen. Der über den »grünen« Planungsbereich hinausgehende, ungebremste Verfall macht nun auch jene skeptisch, die sich bisher im östlichen Teil Bruckhausens sicher wähnten. Dass die Entwicklungsgesellschaft ihr Büro in der angeblich erhaltenswerten Reinerstraße geschlossen hat und umgezogen ist, wirkt da wie ein ganz, ganz schlechtes Zeichen.
»Ich werd’ nicht abgerissen«, sagt Erika Mitzkat, »aber ich bin weggezogen.« Jahrzehnte hat sie in dem Stadtteil gelebt, nun war Schluss: »Dieser Müll!« Ihr Sohn fährt sie jetzt immer freitags aus dem Nachbarviertel zum Café am lebendigen Heinrichplatz, wenn Markt ist, und sonntags zur Kirche. Zurück nach Bruckhausen, jede Woche, so lange sie kann und so lange es noch ein Bruckhausen gibt.