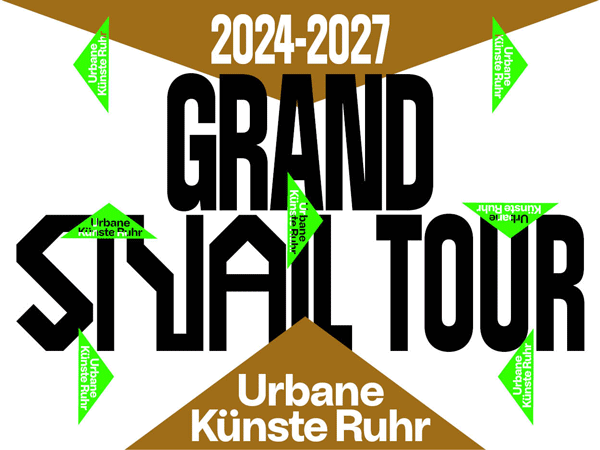Bei ihrer »Ultrasound«-Tour macht Lorde im Kölner Palladium Station.
Sie hängt zwischen den Welten. Irgendwie. Da ist zum Beispiel ihr Name: Bürgerlich heißt sie Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, die neuseeländischen wie kroatischen Wurzeln sind deutlich herauszulesen. Bekannt ist sie indes als, recht kurz und knapp, Lorde. Sehr bekannt sogar – weil sie als Lorde zu denjenigen Künstler*innen gehört, die die Popwelt aktuell am intensivsten durchschütteln.
Im vergangenen Sommer riss sie bereits Festivals wie den britischen Traditionsbrocken Glastonbury mit Leichtigkeit an sich und verleibte sich das von den musikalischen Vorlieben eher kreuz und quer durchmischte Publikum genüsslich ein. Entsprechend sollte Lorde das einzige NRW-Konzert ihrer aktuellen »Ultrasound«-Tour denn auch den Gesetzen der Logik folgend in der Kölner Lanxess-Arena spielen. Eigentlich. Weil die nämlich besetzt war, musste die 29-Jährige ins kleinere Palladium ausweichen. 4000 statt 15.000 Menschen also. Was ganz und gar nicht mehr zum Lorde-Status passt. Eben: Eine andere Welt. Aber die pinselt sie mit Schönheit, Wildheit und einer gehörigen Portion Chaos umso schillernder an.
Laubänder und Riesen-Ventilatoren
Natürlich ist ihre Show – 105 Minuten lang – knallhart durchchoreografiert: Da wäre das tanzende Paar, das stets um Lorde herumschwirrt. Oder die Band, die sogar auf dem Boden liegend für sie spielt. Die auf- und niederfahrenden kreisrunden Traversen, die Lorde immer wieder als Mittelpunkt eines kultischen Scheinwerfer-Stonehenge inszenieren. Dazu Lasergitter, Laserteppiche, Laserpyramiden sowie eine meterhohe Lautsprecherwand, auf der die Künstlerin eine Pyrofackel entzündet. Nicht zu vergessen diese in die Bühnenmitte geschobenen Laufbänder und Riesen-Ventilatoren. Absolut aberwitzig ist das und selten dürfte eine offiziell noch als Club gehandelte Konzerthalle wie das Palladium unter einem derart opulenten Hin und Her geächzt haben. Am Ende geht Lorde im leuchtenden Lampenanzug dann ja auch noch quer durch den Raum zum Mischpult am gegenüberliegenden Ende, um von dort aus die letzten drei Songs zu singen. Oder besser: Zu zelebrieren – weil die Leute da ja längst schon ausgerastet sind.
Und doch hat Lorde nichts von jener Grandezza, jenem Pop-Glitzer oder – das würde ihr Künstlerinnenname ja strenggenommen nahelegen – jener königlicher Erhabenheit an sich, von der die Arenen heutzutage oft genug dominiert werden. Lorde singt nicht nur in einem ihrer bekanntesten Songs: »We’ll never be royals. That kind of lux just ain’t for us.« Übersetzt: Wir werden nie adlig sein, das ist nix für uns. Nein. Sie bewegt sich in jedem Augenblick ihrer Kunst überhaupt in ganz anderen Sphären: Wüst, unkonventionell und völlig choreografiegelöst tanzend und zappelnd und die Bühne durchmessend zu Electrosounds und einem faszinierenden Neo-Techno-Dröhnen, das vor allem den Stücken ihres neuen maximal wuchtigen Albums »Virgin« geschuldet ist. Kurzum: Lorde wühlt ganz tief in den Eingeweiden des Indie-Pop, manchmal sogar an der Grenze des Dark Wave kratzend. Und es ist ein Glücksfall, dass sie das an diesem Abend noch einmal abseits einer riesigen Arena tun kann. Denn hier brechen sich Bedrohlichkeit und Anarchie noch so richtig bahn und, salopp gesagt, knallen einem vor den Latz. »But, baby, what was that?« singt Lorde fragend während einer letzten dieser brachialen Song-Wellen. Verdammt, was war das? Tja, lässt sich nicht genau sagen. War aber ziemlich gut.