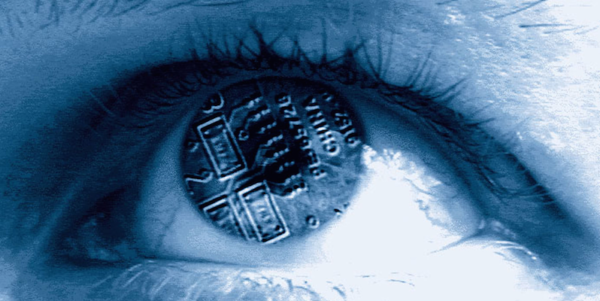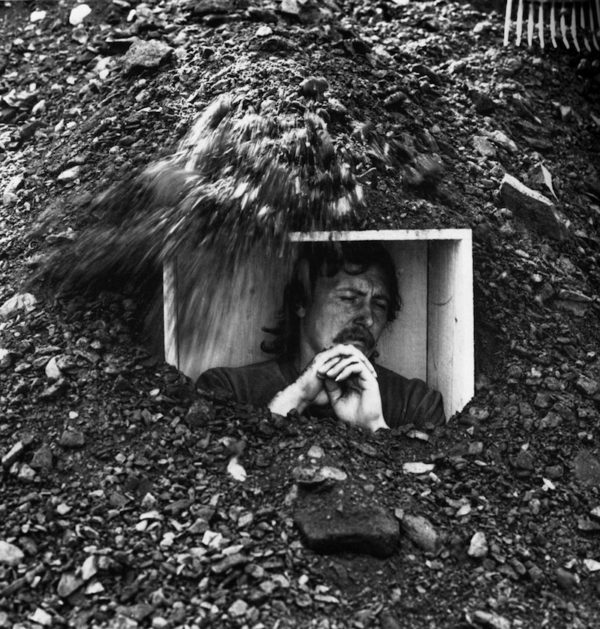Trifft Kunst auf Theorie, ergibt das nicht immer einen Wohlklang. In den letzten Jahre aber haben beide Systeme voneinander zu lernen gelernt, die Künste sind teils konzeptueller geworden, die Theorie wiederum hat von jenen den Mut zu wildem Denken abgeschaut.
Weil im digitalen Zeitalter eine rasante Veränderung der Konstellation der unterschiedlichen Kunstsparten zueinander zu beobachten ist, hat das NRW Kultursekretariat in Kooperation mit Theatern in Nordrhein-Westfalen eine Symposien-Reihe aufgelegt, die Kunst und Theorie aufeinandertreffen lässt. Titel: »Sichtungen«.
Nachdem sich das erste Symposium im Mülheimer Theater an der Ruhr dem Verhältnis von Bild und Musik widmete, nimmt die zweite Tagung im Juni im Schlosstheater Moers die gegenwärtig allein siegreich scheinende Spezies in den Blick: den »Homo oeconomicus«.
Referenten sind der Soziologe Heinz Bude, der Choreograf Jan Ritsema, die Stadt- und Regionalsoziologin Ingrid Breckner, die Schriftstellerin Kathrin Röggla, die Publizistin und Kuratorin Adrienne Goehler sowie die Informatikerin und Publizistin Constanze Kurz. Als künstlerischen Höhepunkt trägt Hanna Schygulla Texte der libanesisch-amerikanischen Dichterin und Teilnehmerin der Documenta 2012, Etel Adnan, vor.
Einige der Referenten haben uns Kurz-Statements zukommen lassen:
INGRID BRECKNER:
Öffentliche Räume stehen weltweit in Stadt und Land überall dort unter Privatisierungsdruck, wo sich Inwertsetzung von Personen oder Institutionen verwirklichen lässt. Privatisierung betreiben einerseits Investoren, die mehr und mehr Präsenz auf öffentlichen Flächen beanspruchen. Die öffentliche Hand geht auf solche Begehrlichkeiten ein, entweder um Investoren ›bei der Stange‹ zu halten oder um Kosten für die Instandhaltung der Flächen einzusparen. Andererseits sind es aber auch die BewohnerInnen und BesucherInnen, die urbane öffentliche Räume durch privates Handeln prägen: Sie wollen möglichst kostenlos parken, färben öffentliche Klangräume mit Mobiltelefonaten, Autoverkehr oder anderen Geräuschen und hinterlassen Müll jenseits existierender Sammelbehälter. Der öffentliche Raum als »Erscheinungsraum politischen Handelns« (Hannah Arendt) verschwindet so mehr oder weniger bemerkt aus dem wissenschaftlichen und alltäglichen Blickfeld und damit auch seine demokratische Relevanz. Denkanstöße liefern uns Ereignisse in Gesellschaften, in denen eine freie Nutzung des öffentlichen Raumes nicht selbstverständlich oder gar gefährlich ist. Zu hoffen bleibt, dass auch demokratische Wohlstandsgesellschaften sich dadurch an den essenziellen Wert virtueller und realer öffentlicher Sphären erinnern und entsprechend handeln.
CONSTANZE KURZ:
Die Frage, wie die heutigen technologischen Umbrüche bewältigt werden können, die durch die Digitalisierung und Vernetzung, durch die Beschleunigung der Kommunikation und Datenverarbeitung und durch die weitreichende Automatisierung und immer »intelligenter« werdende Algorithmen gerade geschehen, ist eines der Kernprobleme unserer Zeit. Schaut man in die Geschichte zurück, ist es nicht ausgemacht, dass die Umwälzungen friedlich und gerecht geschehen. Wir stehen erst am Beginn einer weiteren Beschleunigung der rechnergestützten Automatisierung und Roboterisierung, die sich bis in den Kernbereich menschlicher Fähigkeiten ausdehnt: das Denken. Maschinelle Intelligenz, nicht im Sinne der Science fiction, sondern viel kleinteiliger, im einzelnen »dümmer«, aber ungleich effizienter und schneller als das menschliche Gehirn, wird alltagstauglich. Welche Auswirkungen werden die nächsten Technologiewellen haben? Wie werden wir damit umgehen? An vielen Orten befinden sich die Menschen schon im direkten Konkurrenzkampf mit den Maschinen und Computern. Ist es billiger, den Menschen durch eine Maschine zu ersetzen oder – wie so häufig – die gesamte Produktionsweise so umzustellen, dass sie kompatibel mit den Automatisierungstechnologien wird, gewinnen die Maschinen das Wettrennen. Die große Frage, die wir alle beantworten müssen, ist, ob wir es schaffen werden, die kommenden Veränderungen und insbesondere ihre ökonomischen und sozialen Auswirkungen so zu beeinflussen, dass das Rennen nicht gegen, sondern in Kooperation mit den Maschinen läuft.
ADRIENNE GOEHLER:
Visionen eines zukunftsfähigen Lebens, die sich mit Sinn(lichkeit), Lust und Leidenschaft des eigenen Handelns verbinden, rücken die kulturelle und ästhetische Dimension der Nachhaltigkeit ins Bewusstsein. Nachhaltigkeit ist eine multidimensionale Herausforderung, die nicht nur die Umwelt betrifft. Dabei wird meist nicht verstanden, dass wir auf der Wahrnehmungsebene etwas ändern müssen. Hier kommen die Künste ins Spiel. Die übernehmen immer mehr gesellschaftliche Funktionen, ohne dass ihre Töpfe wüchsen. Deutschland geht mit dem einzigen nachwachsenden Rohstoff, über den es verfügt, die schöpferische Fähig-keit, schlecht um. Nötig ist ein Wechsel vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft, in der die intrinsische Motivation zur Arbeit eine größere Rolle spielt. Deshalb sollte es ein Grundeinkommen geben, das allein eine Entschleunigung der Lebensverhältnisse bewirken kann. Daher lautet der Dreisatz: Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung braucht bedingungsloses Grundeinkommen.
Daneben wird Jan Ritsema über die Strategien und Schwierigkeiten sprechen, sich als Künstler der Kapitalisierung und der Indienstnahme durch das Kapital zu entziehen. Kathrin Röggla berichtet vom Problem, aus solchen Phänomenen wie Finanzmarkt und -krise einen Roman zu machen. Heinz Bude schließlich wird Gedanken über Solidarität im Neoliberalismus vortragen.
Im November 2014 folgt Symposium III im Forum Freies Theater in Düsseldorf zum Themenkomplex »Authentizität und Differenz«.
20. & 21. Juni 2014. www.schlosstheater-moers.de + www.nrw-kultur.de