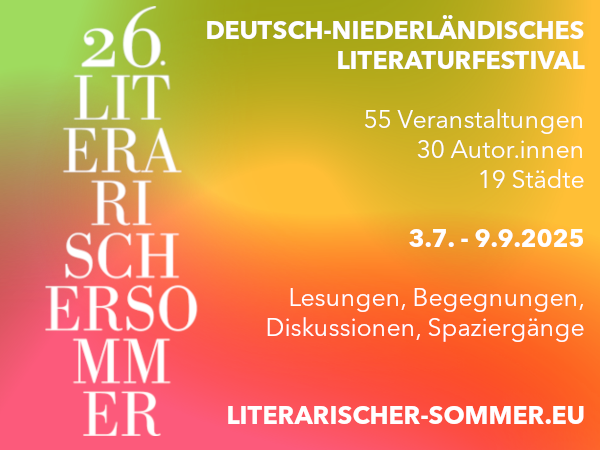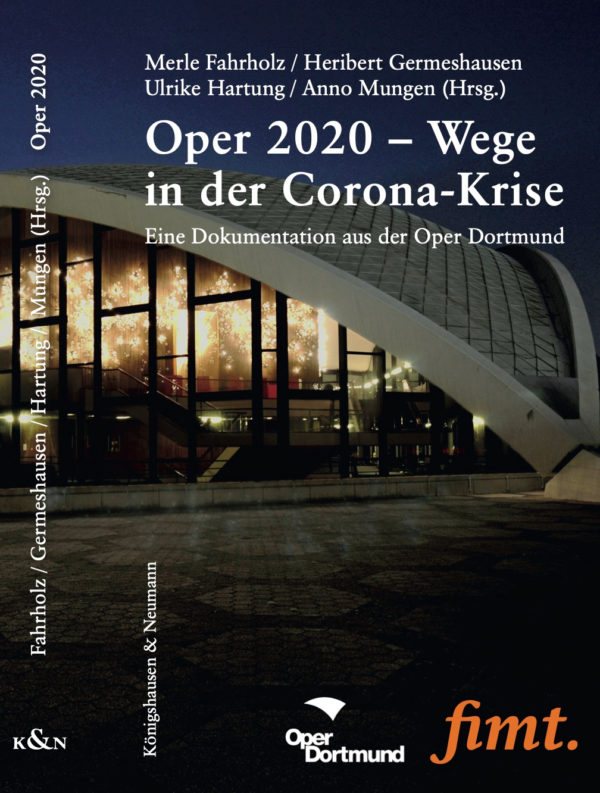Aus dem Bühnendunkel tritt die Merteuil nach vorne, da hat die Musik noch nicht eingesetzt. „Quartett“ leuchtet auf dem Bühnenportal auf, „von Luca Francesconi“, „nach Heiner Müller“, „(nach Laclos)“ steht in den Übertiteln und auf einer alten Schultafel im Hintergrund. Regisseur Ingo Kerkhof macht gleich einmal die komplizierte historische Schichtung dieser Oper klar.
Von einem Barock-Sofa zieht die Merteuil einen Schutzbezug herunter. Es ist ihr Alleinspiel, das hier beginnt, und vielleicht ist es nur ein Erinnerungsspiel. Rechts ragt ein roher Baumstamm in den Bühnenhimmel wie die Weltesche in Hundings Hütte. Oder warten wir hier auf Godot? Nein, denn nur wenig später senkt sich von oben üppiges Laub herab. Die falsche Sorte für Richard Wagner. Es ist eine Trauerweide. Zu viel für Vladimir und Estragon. Und doch: Später, wenn Valmont da mit seiner Melone auf dem Kopf mit der Merteuil spielt, wirken sie für einen Augenblick wie die beiden Beckett-Clowns.
Zunächst bleibt aber die Merteuil lange mit ihren Erinnerungen allein, spürt ihnen im Geruch einer Jacke, die unter dem Schutzüberzug auf dem Sofa lag, nach, gibt sich ihrer Borderline-Störung hin und ritzt mit einem Messer die Hand. Das Blut, das sie in ein Glas tropfen lässt, wird am Ende Valmont vergiften.
Die Mezzosopranistin Allison Cook ist diese Merteuil. Die gesamten 90 Minuten der pausenlosen Oper hat sie die Bühne fest im Griff, in einer fast unheimlichen Weise. Nichts ist gespielt (außer einem Orgasmus, den sie Valmont vortäuscht), jede Kälte in ihrem Blick, jede Gemeinheit, jede sexuelle Übergriffigkeit schmerzt. Allison Cooks wahrhaftiges Spiel ist so stark, dass es sogar auf die Dinge abstrahlt. In ihrer Hand wird der Plastik-Tumbler für Augenblicke zu Glas, die E-Zigarette zu einer echten.
Aus Laclos’ Briefroman „Les Liaisons dangereuses“ destillierte Heiner Müller sein Stück „Quartett“. Tatsächlich allerdings ein Duett. Denn nur die Marquise Merteuil und der Vicomte Valmont liefern sich hier den Schlagabtausch, ihre Opfer Madame de Tourvel und Volanges tauchen nur im Spiel zwischen ihnen auf. Das Spiel der Verführung wird so noch deutlicher zu einem Kampf zwischen diesen beiden und gegen die Liebe – oder sich selbst. Die Kluft zwischen den Mächtigen und ihren Opfern ist so groß, dass deren leibhaftige Anwesenheit gar nicht mehr nötig ist. Von den letzten Tagen des Adels vor der französischen Revolution zieht sich eine Spur zu den entleerten Formeln der romantischen Liebe im 20. Jahrhundert.
Luca Francesconi hat mit „Quartett“ einen formalen Zwitter geschaffen. Die Reduktion auf nur zwei Personen macht es eigentlich zu einer idealen Kammeroper. Der reduzierte Streicher- und Bläserapparat im Graben (Leitung: Philipp Armbruster) ebenfalls. Dazu komponiert Francesconi dann allerdings ein enormes Schlagwerk inklusive Flügel und Celesta und dehnt mit Live-Elektronik und Zuspielern (vom renommierten Institut IRCAM besorgt) den Klang in den Raum aus. Der Italiener ist kein feinsinniger Klangmagier wie etwa Beat Furrer, aber ganz gewiss auch kein Expressiver wie Wolfgang Rihm. Dass er bei Berio und Stockhausen studiert hat, ist seinem intellektuell-abstrakten Duktus klar anzuhören. Großartig wird seine Partitur immer dort, wo sich die Schichten häufen, nicht zu aufwallenden Klangmassen, sondern kontrapunktisch ausgeklügelten Ideengeflechten. Etwas aufgesetzt dagegen wirken einige allzu vordergründige Zitate.
Wenn Valmont in der Erinnerung der Merteuil dann endlich leibhaftig wird, hat Allison Cook längst die Bühne und das Publikum fest in der Hand. So sehr sich Christian Bowers auch redlich müht, ihr darstellerisch Paroli zu bieten, bleibt er im Vergleich doch immer etwas opernhaft. Der Inszenierung von Ingo Kerkhof tut das freilich keinen Abbruch, da er ohnehin die Merteuil klar in den Mittelpunkt stellt. Die Rollenwechsel der beiden Kontrahenten, wenn sie zu den Verführungsopfern werden oder ihre Rollen tauschen, deutet Kerkhof im Kostüm an. Mehr braucht es auch nicht, denn viel mehr konzentriert sich die Inszenierung auf den intellektuellen Schlagabtausch, auf das vertrackte Spiel mit pervertierten Ideen und Philosophien. Das macht den Abend nicht eben zugänglicher, aber umso lohnender. Wer sich auf „Quartett“ in Dortmund einlässt, kann in den vertrackten Windungen der Klänge und Gedanken ein oft teuflisches intellektuelles Vergnügen finden, den Kern von Laclos-Müller-Francesconi.
Wieder am 27. April und 5., 11., 17. Mai