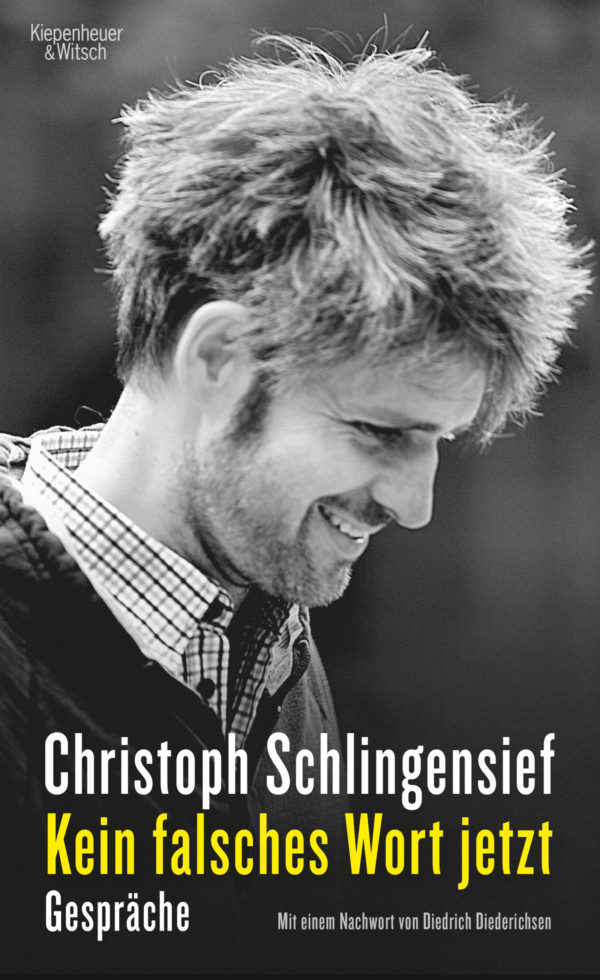Sehr jung sieht sie aus, schmal, nahezu mädchenhaft. Erwachsen, wie manchmal Kinder wirken. An der Hand trägt Aino Laberenz den goldenen Ehering. Auf ihrem Unterarm sieht man ein Tattoo mit einem Anker. Die Tätowierung hat sie von einem ihrer drei Brüder zur Hochzeit bekommen und erst ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes Christoph Schlingensief anfertigen lassen. »Christoph gibt mir so Halt.« Wie sie es sagt, klingt es selbstverständlich. Einfach so. Keine Mystifikation. Auch keine Schlagzeile für den Boulevard.
Dass sie die Ehefrau war und nun die Witwe von Schlingensief ist, akzeptiert sie als »Zustand« und nimmt die »Bezeichnung« an. Sie kann sagen: »Er hat mich extrem geprägt« und »Ich verstehe ihn ein Stück weit besser nach seinem Tode« und gleichzeitig: »Ich mache mein Ding.« Die Prominenz oder wie man den Status nennen soll bei jemandem, der mit seinen Aktionen, Interventionen, Filmen, Inszenierungen, sozialen Plastiken und Performances die Republik durchgoren hat, die deutsche sowie Österreich und die Schweiz, das sei ihr »egal« gewesen.
Ihr Leben ist dreigeteilt. Die eigene Arbeit. Die hatte sie vor, während und nach Schlingensief. Die Bühnen- und Kostümbildnerin hat nach ihrer Assistenz am Schauspielhaus Bochum mit Nicolas Stemann, René Pollesch, Armin Petras, Schorsch Kamerun und kontinuierlich mit Schlingensief gearbeitet, darunter in Bayreuth, Berlin, Wien und im brasilianischen Manaus. Mit Kamerun bereitet sie am Düsseldorfer Schauspielhaus das Konzertschauspiel »Sender Freies Düsseldorf« vor. Ein von Quotendruck entlasteter, unabhängiger, unbegrenzt ausstrahlender Piraten-Hörfunk peilt spielerisch die Einübung in direkte Demokratie an. Die Kunsthistorikerin Laberenz interessiert sich auf der Bühne für extrem geformte Gegenwart und entschieden für Regisseure, »die ein Anliegen haben«. Kamerun, der freundliche Anarchist, gehört dazu.
DAS AUSWÄRTIGE AMT STIEG AUS
Dann ist da die Nachlass-Verwaltung. Dazu gehört, dass Aino Laberenz als Herausgeberin den Schlingensief-Band »Ich weiß, ich war’s« publiziert. Und eben Afrika, das »Zukunftsfeuerwerk«, wie Schlingensief schreibt, an dessen Vorgaben sie sich immer noch halten könne. Im Operndorf in Burkina Faso, nahe Laongo, war sie zuletzt im August, wie fast alle zwei Monate: »Das ist wichtig für das Projekt und auch für mich selbst.« 50 Kinder zwischen sechs und acht Jahren, Mädchen wie Jungen, haben die erste Klasse beendet, besonderer Wert wird auf Musik und Kunst gelegt; einen Lehrer für Film gibt es auch. Sechzehn Gebäude stehen bereits. Nach der Schule wurde eine Krankenstation gebaut. Die Geschäftsführerin der gemeinnützigen GmbH musste in ihre Funktionen hineinwachsen. Sie spricht mit Bürgermeistern, Häuptlingen und Ministern, hat die Finanzen im Auge. Die Spenden gehen hoch und runter. Das Goethe Institut engagiert sich noch stark. Die Bundeskulturstiftung hatte sich beteiligt. Das Auswärtige Amt indes stieg mit Westerwelle aus. Jüngst ließ die Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke wissen, dass sie sich mit Maßnahmen an der zahnmedizinischen Versorgung beteiligen wolle.
Nachdem sich Aino Laberenz während der Zeit mit Schlingensief im Hintergrund gehalten und »verkrümelt« habe, wenn es Interviews zuhause und überhaupt Öffentlichkeit gab, musste sie »wie im Schnellwaschverfahren« lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die Übergabe und Annahme des Erbes war bei beiden eine bewusste Entscheidung. Die Belastung liege für sie darin, es einfach gut machen zu wollen. Nicht darin, dass das eigene Leben sich in Teilen einer anderen Person widmet.

Sie spricht nicht in seinem Namen. »Ein Satz wie »Das hätte er jetzt gut gefunden«, würde mir extrem schwer fallen.« Es gibt die Differenz zwischen der Privatperson und der Verwalterin des Vermächtnisses. Offenbar kann Aino Laberenz beide Rollen – »meine persönlichen Emotionen und das, was ich arbeite« – besser trennen als manch anderer, der mit Christoph Schlingensief zu tun hatte. Ansonsten gilt: »Ich gehe mit meinen Gefühlen eher nach Hause«.
Das sagt sie ruhig, diskret und entschieden. Diese entspannte Ruhe – »Ich war manchmal sehr unbeeindruckt von ihm« – ergänzte Schlingensiefs fiebrig verzehrenden Elan und wirkungsmächtigen Furor. Bei ihm war Überforderung von sich und anderen immer Teil einer manischen Produktion – bis zur Selbstbeschädigung und konfrontativen Rücksichtslosigkeit. Er war gewissermaßen Herzog und Kinski in einer Person. Sie seien Pole, aber auch ganz gute Spiegel füreinander gewesen, und konnten sich in ihren Phantasien treffen.
SIE TRAFEN SICH IN ZÜRICH AM SCHAUSPIELHAUS
1981 geboren, war Aino Laberenz Anfang Zwanzig, als sie sich am Schauspielhaus Zürich trafen und sofort viel Gemeinsames erkannten. Beide fremdelten mit der Schweiz, beide kamen aus dem Ruhrgebiet – sie aus Wetter an der Ruhr, wo der Vater, obgleich Lehrer, zu Zeiten ein Kino betrieb; außerdem war sie mit Richard Wagner von Hause aus vertraut und Bayreuth-erfahren, was noch nützlich sein würde. Übrigens lesen sich in »Ich weiß, ich war’s« die Passagen über Wolfgang Wagner und den Clan mit am komischsten – als Stichworte mögen eine dänisch königliche Leberpastete, eine von Gudrun aufgetischte spezielle Keksdose sowie die gemeinsame Passion von Wolfgang und Christoph fürs Wohnmobil den Appetit auf die Lektüre anregen.
Aino Laberenz hat eine Weile gebraucht, um die Texte in die Hand zu nehmen. Die Beschäftigung bedeutete »Härte« für sie. »Etwa eineinhalb Jahre habe ich in einer Art Wolke gelebt, die auch Schutz bedeutete. Langsam merke ich, dass er wirklich nicht wiederkommt.« Sein Tod im Sommer 2010 war auch von ihr lange nicht in letzter Konsequenz ge-sehen: »Ich hab’ schon geglaubt, wir würden beide 80.«
Irgendwann konnte sie die Texte wie Informationen lesen, wie Lehrmaterial, »fast neutral interessiert«. Knapp 300 Seiten Schlingensief, angelehnt an seine Lesereisen und dort vorgetragene Lebens-Stationen; das meiste wurde aufgezeichnet mit dem Tonband und von ihm noch redigiert. Man liest ihn, wie man ihn sprechen hörte: in freier Rede. »Ich weiß, ich war’s« ist keine Biografie. Sie sei froh, sagt Aino Laberenz, dass man am Ende des Buches nicht den Eindruck habe, jetzt alles zu wissen. Zumal sie den Nachlass des mit 49 Jahren Verstorbenen nicht »verballern« möchte. Es gebe noch unheimlich viel zu sortieren, auszuwerten, darzustellen.
»Kein Mausoleum. Ein Lebenszeichen« sei das Buch, wie sie im Vorwort schreibt. Man wird es lesen als Reifezeugnis der Autonomie: Ich-Sagung und Ich-Werdung, Ich-Beharrung und Ich-Verlust von jemand, der sich nietzscheanisch »Schmerzmensch« und »Leid-Wesen« nennt – nach dem nie groß genug zu denkenden Bruch zwischen Gesundheit und Krankheit und der dem innewohnenden Kränkung. Gerade für einen Egomanen. Die Krankheit, sagt Aino Laberenz, habe er als Entjungferung empfunden. Mithin als Verlust der Unschuld. Einen Satz wie »Ich hätte nur gerne wieder meine Zartheit zurück« übersteht man kaum, ohne selbst zu heulen.
SCHLINGENSIEFS PARANOIA, SEINE HYPOCHONDRIE
Fragmentarisch, aber konsequent in der Entwicklung, ist es ein Buch mit Anfang – Mitte – Schluss, doch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, wie Godard zitiert wird mit der Ansicht über das, wie ein Film auszusehen habe. »Ich weiß, ich war’s« hadert, kommt mit sich ins Reine, denkt nach über den Künstler und Menschen (»Der Raum überprüft uns und nicht wir den Raum.«) und legt Rechenschaft ab. Dabei stets »unterwegs in seinem eigenen System«, wie Schlingensief es den Behinderten attestiert, mit denen er Theater gemacht hat.
Aino Laberenz erhebt mit dem Buch das Unvollendete zum Prinzip. So wie Schlingensief, der die Lücke als Glück empfand, der Unvollendete blieb. Gerade auch in seinem Widerspruch: sein Humor (»ich konnte oft wie über eine Comic-Figur lachen«, sagt sie) und seine Paranoia, seine Hypochondrie und sein »wahnsinniges Körpergefühl in der Krankheit«, seine Angst und die Fähigkeit, diese produktiv umzuwandeln, die herzliche Naivität und das strategische Talent. Er fand Dunkelphasen wie im Film, das Böse, die Aggression, den Dreck in sich. »Und trotzdem war es wahnsinnig sauber«, wie Aino Laberenz sagt. Er sah sich selbst als »romantischer Quirl« und richtete gegen Ende den Appell an sich: »konkreter zu werden«.
Der Acedia, der Lauheit, auch Trägheit des Herzens genannt, die zu den Sieben Todsünden gehört, hat der frühere Messdiener in Oberhausen sich gewiss nie schuldig gemacht. Ein »sparsamer Ofenheizer«, wie er schreibt, war er nie. Immer voll haftbar. So betrieb er die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben, Realität und Fiktion. So organisierte er methodisch Kippmomente, Schnittstellen, Unschärfen, den Zerfall, Diskontinuität und Asynchronität. Hatte er sein Seelenheil gefunden? Aino Laberenz antwortet, wissend lächelnd, ohne Zögern mit einem klaren Ja.
»Sender Freies Düsseldorf«, Premiere: 5. Oktober 2012; Vorstellungen: 7., 12., 22., 29., 30. Oktober, Kleines Haus; www.duesseldorfer-schauspielhaus.de
Christoph Schlingensief, »Ich weiß, ich war’s«, Hg. von Aino Laberenz, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012, 292 S. mit zahlreichen Fotos, 16,99 Euro; Erscheinungsdatum: 8. Oktober 2012.