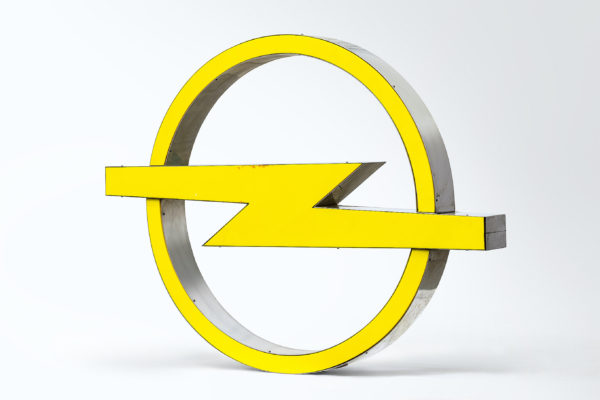Nordrhein-Westfalen führt Honoraruntergrenzen für Künstler*innen in landesgeförderten Projekten ein. Verbände und Kunstschaffende begrüßen den Schritt – warnen aber vor den Folgen, wenn für höhere Honorare nicht auch mehr Geld zur Verfügung steht.
Als erste profitieren seit dem neuen Schuljahr Honorarkräfte in den Programmen »Künstlerinnen und Künstler in die Kita« sowie »Kultur und Schule«: Sie werden jetzt mit 55 statt bisher 37 Euro pro Stunde vergütet – ein Plus von 50 Prozent. Die jährlichen Mehrausgaben dafür lägen bei 1,6 Millionen Euro, erklärte NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU). In diesem Jahr sei dafür noch ausreichend Puffer im Etat; ab 2025 werde das Geld zusätzlich eingeplant. Erst ab 2026 sollen dann Mindesthonorare in allen Kulturprojekten und -einrichtungen gezahlt werden, die selbstständige Künstler*innen beschäftigen und dafür Geld vom Land erhalten. Da viele Angebote in NRW vom Kulturministerium zumindest mitfinanziert werden, betrifft diese Regelung weite Teile der Kulturszene im Land.
Für eine möglichst breite Beteiligung hat das Land eine Kommission aus Vertreter*innen des Ministeriums, Kommunen, Kulturverbänden und Gewerkschaften sowie externen Expert*innen eingesetzt. Das Ergebnis ist eine 18 Seiten lange sogenannte Matrix, in der für alle Kunstsparten festgelegt wird, welche Leistung künftig wie hoch mindestens honoriert werden muss. Das beginnt in Musik und Theater bei 180 Euro für ausführliche Proben und 250 Euro für Aufführungen; dieser Satz gilt auch für Lesungen von Autor*innen. Mit der Größe des Veranstaltungsortes beziehungsweise des Publikums steigen diese Summen schrittweise auf 500 Euro. Topwert in der Tabelle ist die Vergütung für Einzelausstellungen von Bildenden Künstler*innen in Museen mit mehr als 100.000 Besuchenden pro Jahr. Dafür ist künftig eine Honoraruntergrenze von 1200 Euro vorgeschrieben.
Projekte werden teurer
Mit den Mindesthonoraren erfüllt die Landesregierung eine Verpflichtung aus dem Kulturgesetzbuch NRW von 2021. Die verzögerte Umsetzung ist nicht nur selbstverschuldet: Als während der Corona-Pandemie die prekäre finanzielle Lage von Künstler*innen unübersehbar wurde, hatten die Länder auf Initiative der damaligen NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen noch vereinbart, gemeinsam mit dem Bund Honoraruntergrenzen einführen zu wollen. Nach dem Ende der Lockdowns ging die Dynamik dieser Beratungen zusehends verloren; später kamen die Auswirkungen der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der weltwirtschaftlichen Entwicklung auf die öffentlichen Kassen dazu. Zum Juli dieses Jahres hatte der Bund dann Honoraruntergrenzen für all jene Kulturprojekte festgelegt, die er zu mehr als der Hälfte fördert; in Berlin, Hamburg und Brandenburg gibt es schon länger Mindesthonorare in ausgewählten Kunstsparten. Von NRW als größtem Flächenland erhoffen sich viele nun einen Nachzugseffekt auf alle anderen.
Im Kunst- und Kulturbetrieb selbst stößt die Maßnahme auf ein geteiltes Echo: Stellvertretend für viele Akteur*innen begrüßt der Kulturrat NRW die Einführung, weist aber auf zahlreiche Tücken hin. Vor allem werden die Mindesthonorare öffentlich geförderte Projekte um bis zu ein Drittel verteuern. Wenn die zugehörigen Förderetats dann nicht im selben Maße mitsteigen, wird zwangsläufig die Zahl der genehmigten Projekte kleiner. Von der 50-prozentigen Erhöhung des Landeskulturetats, die CDU und Grüne 2022 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten, ist schon längst keine Rede mehr. Im Gegenteil: Aller Voraussicht nach wird 2025 das zweite Jahr in Folge mit einem Minus enden. So könnten Honoraruntergrenzen auch dazu führen, dassKünstler*innen in landesgeförderten Projekten zwar endlich mehr verdienen, die Zahl dieser Projekte aber deutlich sinkt.