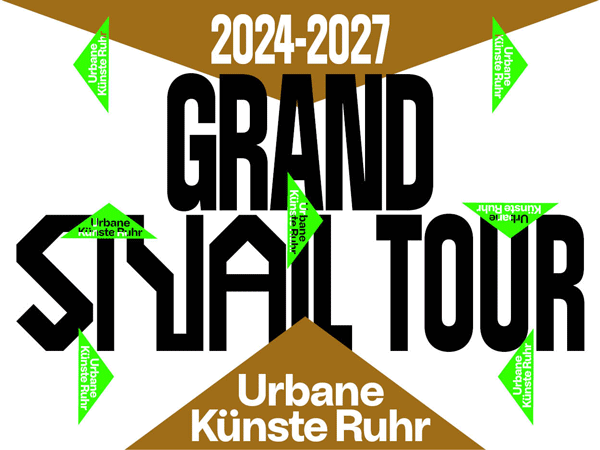In »Gewölk« schreibt Paula Kläy über das Herstellen von (Theater)Illusion, über Verlust und Vergehen. In ihrer Uraufführung in Münster spielt Regisseurin Tamara Aijamathiesen dieses skurrile Spiel gerne mit.
Das Saallicht bleibt erst mal an. Da hat die Lichttechnik ihre Finger im Spiel. Denn die hat ihre eigene Rolle in diesem Stück. Paula Kläy war in der vergangenen Spielzeit Hausautorin am Theater Münster. Jetzt wurde dort ihr Text »Gewölk« uraufgeführt – ein knapp 30-seitiges Stück, in dem das Theater und seine Erzählungen selbst durchleuchtet, hinterfragt und in witziger Manier beschrieben werden.
Die Lichttechnik im Studio probiert dann auch noch die wildesten Lichtstimmungen aus, um einen Raum zu schaffen, in dem Geheimnisse offenbart werden können: in Pink, in Rot-Grün-Gelb funkelt die Bühne dann. Jede Illusion wird da zur Spielerei. »Wunderlich«, das ist ein Wort aus Kläys Text. »Das soll hier doch ganz wunderlich werden! Es soll ganz schön werden!«, heißt es. Und nach einem etwas müden Einstieg wird es das auch: eigenwillig-kurios formuliert Kläy das Werden (von Fiktion) und das Vergehen (des Lebens) und Tamara Aijamathiesen inszeniert eine skurrile Geschichte zwischen Spiel und Reflexion.
Auf der Bühne: Mavie (die auch Marie heißen könnte, denn der Autor hat eine Sauklaue), Peter (der Autor, der selbst zum Spieler wird) und der Regisseur (der natürlich »nur eine Theaterfigur [ist], die ein Regisseur ist«). Sie sprechen über den Tod, nachgeahmtes Lächeln und das Weinen im Publikum als größten Erfolg des Autors. Sie erzählen von der Demenz des Vaters. Vom tragischen Bühnentod und den Aphorismen des Autors. Dazwischen berichtet die Stimme der Regieanweisung, dass ein kleiner Käfer mit einem winzig kleinen Spazierstock zwischen den Bühnenwänden spaziert.
Kläy schenkt Gedankenfunken
Paula Kläy schenkt Gedankenfunken, unvermittelt springen sie uns an, um dann – ungeachtet aller Kürze – tiefe Spuren zu hinterlassen. Anton von Bredow hat dafür das Studio als Spiellandschaft hergerichtet, zwischen durchsichtigen Vorhängen und mit Miniatur-Eisenbahn und Watte-Dampf für die Lok, die auf einem Podest über einem angedeuteten, real großen Gleisbett ihre Kreise fahren kann. Auf der Bühne wie im Text vermischen sich die Welten. Der Schritt zwischen Realität und Illusion ist kein großer und wird mit Leichtigkeit gemacht. Und alles Gemachte, vom Autor Ersponnene, vom Regisseur Angeordnete oder von der Technik Inszenierte, ist offensichtlich. Selbst der Wind hinter der Tür zur Hinterbühne ist ein selbstgehauchter. Christian Bo Salle haucht ihn, wenn er als überambitionierter Regisseur ins Bühnenbild tritt. Er haucht ihn aus Überzeugung. Ilja Harjes’ zweifelnder Autor haucht ihn ebenfalls, allerdings mehr aus Trotz. Er ist der mittlerweile groß gewordene, beleidigte Junge, dessen Eltern ihm schon damals eine gescheiterte Existenz prophezeiten. Luise Zieger als Mavie ist die Stärkste in dieser Spiel-Runde. Wenn sie auf der Bühne weinen soll, nimmt sie eben eine Zwiebel zu Hilfe. Stellt sich unter die Straßenlaterne und erzählt im Schein ihre Geschichte(n).
Es ist stets ein doppeltes Spiel auf dieser Vorzeige-Bühne. Vermeintliche Banalitäten durchkreuzen Gedankengänge, hängen einem nach: Die zwei Tauben, die laut Regieanweisung über die Bühne fliegen und Mavies Eltern sind. Der (Bühnen)Nebel, »der alles in eine Unschärfe zieht, in der die einzig klaren Momente zu finden sind«. Paula Kläy schreibt in lauter Anfängen vom Vergehen. Bei allem Spaß ist das vor allem ein beruhigender, tröstlicher Akt.
WIEDER AM 14. FEBRUAR, 5. UND 22. MÄRZ
STUDIO, MÜNSTER