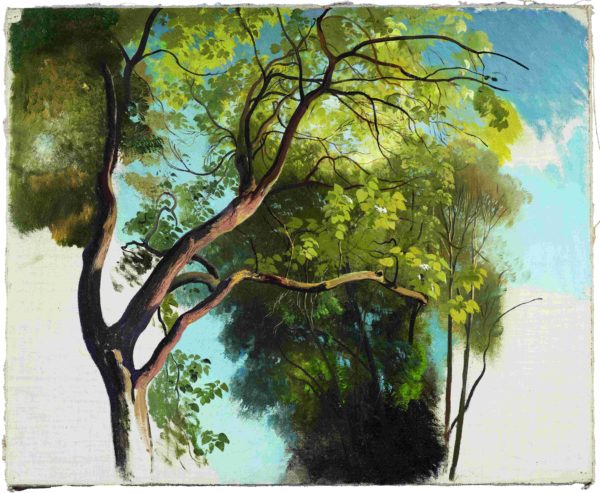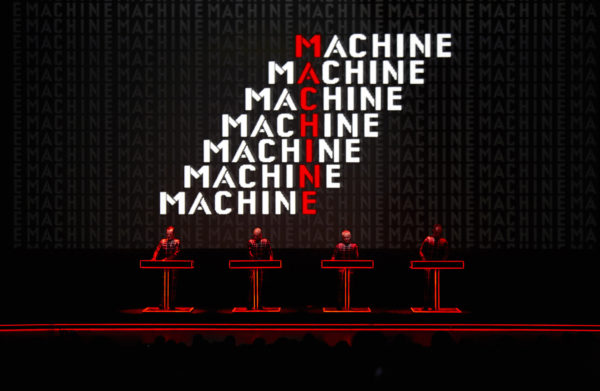Vor zwei Jahren ist der Düsseldorfer Künstler Hans-Peter Feldmann gestorben. Dem gewitzten Collagisten, der die Absurditäten des Alltags in einem Bilderatlas verdichtete, widmet der Kunstpalast nun eine Werkübersicht.
Bilder zu sammeln und die Fundstücke nach Lust und Laune zu einem »Museum im Kopf« zu arrangieren, das war ihm gleichsam in die Wiege gelegt: Schon als Kind faszinierten Hans-Peter Feldmann Briefmarken, die er von der Post seines Vaters ergatterte, um sie in einem Album zu verewigen. Eine weitere Miniaturgalerie widmete der kleine Hans-Peter den sogenannten Sanella-Bildern – die gab es in den 1950er Jahren beim Kauf von Margarine als Gratisdreingabe.
Ausschneiden, Sammeln und Einkleben, dieser dreistufige Werkprozess erwies sich als richtungsweisend für das gesamte Schaffen des Künstlers, der 1941 in Hilden geboren wurde und 2023 in Düsseldorf starb. Amateurfotos vom Flohmarkt, Postkarten, Zeitungsausschnitte, Werbeanzeigen – die unspektakulären, scheinbar banalen visuellen Zeugnisse des Alltags waren der Zündstoff seiner Kreativität. Sich solche Trouvaillen anzueignen, sie in den Bezirk seiner witzig-skurrilen Collagen zu überführen, darin bestand die Mission dieses Künstlers, der aus vielen Quellen schöpfte und doch ein Original blieb.
Das unterstreicht nun eine Retrospektive im Düsseldorfer Kunstpalast – die erste Werkübersicht nach seinem Tod im Mai 2023, die letzte, an deren Vorbereitung Feldmann noch mitgewirkt hat. Felicity Korn, die Kuratorin, hat rund 80 Arbeiten ausgewählt, die seine bildnerische Strategie der Verfremdung und Kontextverschiebung vor Augen führen. Von frühen Fotos über Feldmanns Skulpturen mit Alltagsgegenständen bis zu späten Werken, die in Düsseldorf erstmals gezeigt werden, entfaltet sich ein Parcours, bei dem es viel zu staunen gibt – und zu lachen.
Die erste nackte Frau
Den Ort darf man als idealen Schauplatz für eine solche Hommage betrachten. Im Katalog berichtet Korn, dass Feldmann bei einer Besichtigung der für die Ausstellung vorgesehenen Räume aus seiner Verbundenheit mit dem Haus am Ehrenhof kein Hehl machte: »Der Kunstpalast ist mein Museum«, sagte er damals und berichtete, sein erster Museumsbesuch habe ihn unter der Direktive des Onkels just hierhin geführt. Besonders beeindruckte ihn damals die Begegnung mit einem Bild von Peter Paul Rubens, dem Gemälde »Venus und Adonis«. Nicht etwa die bravouröse Malerei nahm seine Aufmerksamkeit gefangen, sondern die römische Liebesgöttin – denn die war, so Feldmann, die erste nackte Frau, die er in seinem Leben gesehen hatte.
Vielleicht wirft diese Anekdote auch ein Schlaglicht darauf, dass sich in seinem Œuvre auffällig viele verführerische Frauen tummeln. Fotos von Schauspielerinnen, deren Köpfe er aus Illustrierten ausgeschnitten hatte, zieren schon in den 1960er Jahren eine doppelseitige Collage. Später extrahierte er nach demselben Prinzip »Sitzende Frauen in Gemälden«. In der Düsseldorfer Ausstellung erstmals präsentiert wird eine Installation, die sieben verschieden große Reproduktionen von Giorgiones »Schlummernder Venus« zusammenführt. Mit der Hommage an den – freizügigen und zugleich keuschen – Renaissance-Akt, heute in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden aufbewahrt, erweist er dem Venuskult seiner Kindheit nochmals eine ironische Reverenz.
2011 hatte Feldmann mit einer Soloshow im New Yorker Guggenheim Museum endgültig den Gipfel der internationalen Kunstwelt erklommen. Doch verlief seine Karriere alles andere als geradlinig. Nach einer Ausbildung als Chemielaborant heuerte er in der Schifffahrt an. Zurück im Rheinland kam er durch einen Kellnerjob in der Kneipe Zur Uel in Kontakt mit der Düsseldorfer Kunstszene. Eigene künstlerische Ambitionen allerdings erlitten einen Rückschlag, als die Kunstakademie Düsseldorf seine Bewerbung ablehnte. Stattdessen nahm ihn die damalige Kunstschule Linz auf.
Voyeur und Nippes-Fan
Zwischen 1968 und 1980 entstanden »Bilderhefte«, in denen der bekennende Voyeur in serieller Anordnung ausbreitete, was ihm dokumentwürdig erschien. Das konnte – cherchez la femme auch hier – das Inventar einer Garderobe sein (»Alle Kleider einer Frau«). Oder Autoradios, die angeblich im Moment des Fotografierens einen guten Song spielten (»Car radios while good music is playing«).
Seinem Zickzackkurs treu bleibend, womöglich auch enttäuscht von der Resonanz des Kunstbetriebs und der Öffentlichkeit, hing er die Kunstproduktion 1980 an den Nagel und widmete sich seinem Laden, den der Nippes-Fan 1975 in Düsseldorf eröffnet und später an den Burgplatz verlegt hatte. Dort bot er ein Sammelsurium an, das aus technischen Antiquitäten, Kunst, Kitsch, Spielzeug und Souvenirs bestand. Handverlesen und liebevoll zusammengetragen. Ein Gesamtkunstwerk – so jedenfalls sah es Feldmann, der seinem Laden einen höheren Kunststatus zubilligte als dem, was in Museen und Galerien an den Wänden hängt. Das Gütesiegel einer angesehenen Kunstinstitution erhielt er 2015, als er den Laden dichtmachte: Das Münchner Lenbachhaus überführte die komplette Einrichtung in seine Sammlung.
Dass Feldmann den Rückzug vom Kunstbetrieb 1989 rückgängig machte, ist dem Kurator Kasper König und dem Verleger Walther König zu verdanken. Die Brüder, Bewunderer seiner beiläufig-humoristischen Kunst, überredeten ihn zum Comeback, organisierten eine Wanderausstellung und brachten die erste Monografie heraus. Von da an ging’s steil bergauf. Die Krönung war der prestigeträchtige Hugo Boss Prize, der ihm 2010 verliehen wurde. Wie Feldmann mit dem opulenten Preisgeld umging, das bestätigte seine Skepsis gegenüber der Liaison von Kunst und Geld: Die 100.000 Dollar ließ er sich nicht direkt aufs Konto überweisen, sondern in 1-Dollar-Scheinen aushändigen. Mit ihnen tapezierte er vorübergehend dieWände seiner Preisträgerschau im Guggenheim. Die Moral der Installation: Geld regiert die Welt, auch im Museum.
»HANS-PETER FELDMANN. KUNSTAUSSTELLUNG«
18. SEPTEMBER BIS 11. JANUAR 2026
KUNSTPALAST, DÜSSELDORF