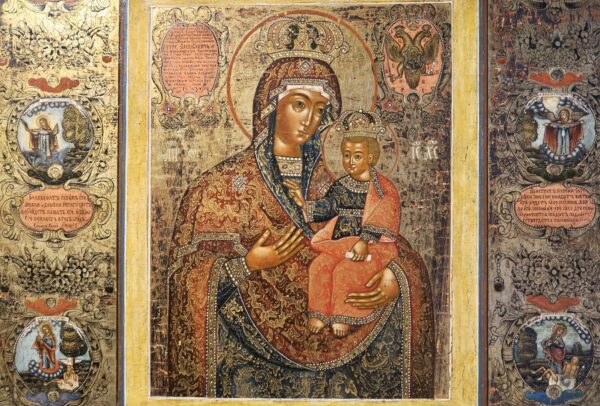Eines Tages beschloss Jan Jessen, über die Krisenherde der Welt zu berichten. Die Vorzeichen dafür waren denkbar ungünstig. Denn eine Auslandsredaktion hat die Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ) nicht – dafür wohl einen der ungewöhnlichsten Reporter des Landes: Mit Wissen, Empathie und Engagement reist Jessen nach Afghanistan, in die Ukraine oder in den Irak, um inzwischen für alle Titel der Funke Mediengruppe über Konflikte und Krieg zu berichten – und die Geschichten dahinter.
Eilig kommt er die Straße entlang. Jan Jessen nickt kurz, grüßt, bestellt Kaffee, setzt sich an einen der Tische im Essener Unperfekthaus. Und wird nicht mal eine Stunde später schon wieder verschwunden, so schnell gegangen wie gekommen sein. Gerade erst ist er aus der Ukraine heimgekehrt. Gleich hat er noch einen Termin in Düsseldorf, mit dem kurdischen Gouverneur von Dohuk, einer Provinz im Irak. In nur wenigen Tagen geht es für ihn weiter in die Shingal-Region, in den Nordwesten des Irak, wo seine von ihm mitgegründete Caritas-Flüchtlingshilfe Essen eine Schule eröffnen wird. Was dazwischen liegt, ist ein aufmerksames Gespräch über seine außergewöhnliche Arbeit zwischen all den Widersprüchen, den sein Alltag mit sich bringt. Über den Spagat zwischen Deutschland und den Krisenländern der Welt. Zwischen den Bildern der Kriegsgräber in Isjum, die er besucht hat und kälter werdenden Schwimmbädern, über die die Menschen im Ruhrgebiet klagen. Zwischen dem Alltag als Lokalreporter der NRZ und dem permanenten Ausnahmezustand, den der Einsatz als Journalist im Krieg mit sich bringt.
kultur.west: Herr Jessen, von Immanuel Kant stammt der Satz: Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Menschen macht, als er deren wegnimmt. Denken Sie das auch?
JESSEN: Nein. Das Interessante am Krieg ist, dass er sowohl das absolut Böse im Menschen weckt, als auch das absolut Gute hervorholt.
kultur.west: Wie meinen Sie das?
JESSEN: In keiner Situation habe ich so viel Selbstlosigkeit und Barmherzigkeit erlebt wie in Kriegssituationen. Viele Menschen gehen immense Risiken ein, um anderen zu helfen. Zugleich habe ich etwa 1999 auf dem Balkan erlebt, wie sich Nachbarn, die jahrzehntelang friedlich nebeneinander gelebt haben, plötzlich über Nacht bekriegen. Ich war damals im Kosovo und habe so etwas zum ersten Mal gesehen – solche Mechanismen werde ich wohl nie verstehen.
kultur.west: Ich habe in Ihrem Podcast den Satz gehört, das Leben sei in Kriegsgebieten kristallklar. Was meinten Sie damit? Ich stelle mir Krieg entsetzlich verwirrend, chaotisch vor.
JESSEN: Hier in Deutschland läuft das Leben wie hinter einer Milchglasscheibe ab. Wir leben in einer Wattebauschrealität. Im Krieg aber siehst du plötzlich glasklar, wie die Menschen ticken.
kultur.west: Welche Rolle spielt die Schuldfrage bei Ihnen?
JESSEN: Im Ukraine-Krieg ist die Schuldfrage zumindest eindeutig, was Putin anbelangt. Aber seine Soldaten sind in gewisser Weise auch Opfer seiner Politik – und werden zugleich zu Tätern. Die Russen werden aus meiner Sicht von einem Diktator in ein sinnloses Gemetzel gejagt.
kultur.west: Wäre der Ukraine-Krieg ohne Putin zu Ende?
JESSEN: Nein, dazu ist das System in Russland zu verknöchert. Putin ist natürlich das Symbol des Krieges. Er ist derjenige, der ihn maßgeblich vorantreibt. Aber ich hoffe, dass die Russen aufwachen und sich fragen, was macht die Regierung mit unseren Söhnen und unserer Reputation in der Welt?
kultur.west: Wie wird dieser Krieg also wohl enden?
JESSEN: Ich denke, dass er nicht durch Verhandlungen beendet werden kann. Nur dadurch, dass die Russen aus den ukrainischen Gebieten gedrängt werden, weil sie dort einfach nicht hingehören. Und ich kann nur sagen: Die Motivation seitens der ukrainischen Armee ist natürlich unglaublich hoch, bei den Russen eher niedrig.
kultur.west: Fürchten Sie, dass Putin Atomwaffen einsetzen wird?
JESSEN: Ich hoffe, dass das russische Militär diese rote Linie kennt und nicht überschreiten wird. Wenn das nukleare Tabu fallen würde, dann würden auch China und Indien aussteigen.
kultur.west: Wenn die Schuldfrage in Bezug auf die Russen recht klar ist – würden Sie trotzdem von russischer Seite berichten?
JESSEN: Ja, natürlich. Aber die Russen würden mich nicht lassen. 2020 war ich schon einmal im Osten der Ukraine, und wollte aus den besetzten Gebieten im Donbass berichten. Aber es gab keine Akkreditierung. Aber auch die ukrainischen Streitkräfte sind da sehr restriktiv.
kultur.west: Warum?
JESSEN: Dieser Krieg ist unglaublich modern. Sie fürchten jedes falsche Foto, dass Positionen verraten werden könnten. Journalisten, die verletzt werden, sind für eine Truppe zudem nur Ballast. Ich muss aber auch sagen, dass Berichte von der Front nicht so mein Ding sind. Ich habe etwa in Mossul Häuserkämpfe hautnah erlebt – das würde ich nicht wiederholen wollen. Mich interessiert eher, was mit den Menschen in den Kriegsgebieten geschieht, wie sich ihr Leben verändert.

kultur.west: Was treibt Sie an?
JESSEN: Nachhaltige Berichterstattung ist mir wichtig. Deshalb reise ich auch immer wieder an Orte zurück, die gerade aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten sind. Das war auch schon 2011 mein Antrieb, als die Amerikaner aus dem Irak abgezogen sind. Ich wollte damals wissen, was aus den Menschen geworden ist. Und vor allem, was aus den Versprechungen des Westens.
kultur.west: Zugleich könnten die Gegensätze in Ihrem Berufsalltag kaum größer sein.
JESSEN: Ja, das stimmt. Ich kam kürzlich aus einem Kriegsgebiet und habe als nächstes dann über maskenfreies Einkaufen in Venlo berichtet. Das sind schon ziemliche Gegensätze.
kultur.west: Die Kriegsberichterstatterin Anja Niedringhaus hat einmal gesagt, dass etwas nicht bekannt wird, wenn sie es nicht fotografiert. Gilt das auch für Ihre Arbeit?
JESSEN: Ja, absolut. Krieg ist hier etwas Abstraktes. Ich versuche ihm, ein Gesicht zu geben.
kultur.west: Anja Niedringhaus ist als Bilderkriegerin bezeichnet worden. Sind Sie ein Textkrieger?
JESSEN: Nein, ich würde mich auch nicht als Kriegs-, sondern als Konfliktberichterstatter bezeichnen. Meine Arbeit ist nicht an, sie ist hinter der Front.
kultur.west: Sie waren in der Ukraine, als der Krieg losging.
JESSEN: …ja, das war ein totaler Zufall. Ich hatte Freunde besucht. Am 24. Februar rief mich dann mein Chefredakteur an. Ich habe daraufhin Leute begleitet, die nach Deutschland flüchten. Niemand hat damit gerechnet, dass der Krieg so groß werden wird. Gerade noch haben diese Menschen über Kindergartenplätze und Sonderangebote im Supermarkt nachgedacht. Plötzlich stehen sie in einem ewig langen Stau an der Grenze. Mit einem kleinen Köfferchen und Rucksack. Mit diesen Menschen zu sprechen, ihre Fassungslosigkeit zu spüren, über sie zu berichten – das fand ich total wichtig. Und das auch weiterhin: Dass Krieg einfach unglaubliches Elend, unglaubliche Not, unglaubliches Leid bedeutet.
kultur.west: Zugleich sehnen sich die Menschen vor allem nach Normalität.
JESSEN: Ja, so ist es auch jetzt gerade in der Ukraine. Ein Krieg ist ja kein Solitär. Es ist ja nicht so, dass da ein ganzes Land in Schutt und Asche liegt. Im Gegenteil. In den allermeisten Städten im Westen läuft das Leben normal. Dort herrscht normaler Alltag. Aber je mehr du Richtung Osten kommst, desto kritischer wird es. Aber selbst in Städten wie in Nikolajev versuchen die Menschen, sich im Leben einzurichten.

kultur.west: Wie gehen Sie damit um, dass Sie den Menschen unmittelbar eigentlich so gut wie gar nicht helfen können?
JESSEN: Ich engagiere mich ja viel sozial. In gewisser Weise ist meine humanitäre Hilfe auch ein Ausgleich. Und manchmal heule ich mit den Leuten auch. Wenn ich merken würde, das berührt mich nicht mehr, was ich da sehe, dann würde ich aufhören. Genauso würde ich aufhören, wenn ich merke, das alles berührt meine Seele zu sehr. Wenn ich beginnen würde, davon zu träumen.
Zur Person
Jan Jessen kam in Münster zur Welt, wuchs in einem, wie er sagt, konservativen Elternhaus in Rheinhessen auf und arbeitete zunächst als Krankenpfleger, ehe er Journalist wurde. Er engagierte sich früh politisch und gründete etwa das Netzwerk Attac am Niederrhein mit. Zum Journalismus kam er als Quereinsteiger. Er volontierte bei der NRZ, wurde zunächst Lokalredakteur in Kleve und wechselte dann ins Politikressort. Aus den Krisengebieten berichtete er erst jahrelang im Urlaub. Inzwischen ist Jan Jessen als Kriegsberichterstatter, Kommentator und Reporter für alle Kanäle der Funke Mediengruppe tätig und hat mit »Wie fühlt sich Krieg an« einen eigenen Podcast. Er engagiert sich für das Friedensdorf in Oberhausen, das jährlich Kinder aus Kriegsgebieten medizinisch versorgt und aufnimmt, ehe sie in ihre Heimat zurückkehren. Außerdem gründete er die Caritas Flüchtligshilfe in Essen mit, deren Hilfsprojekte er regelmäßig besucht und unterstützt.