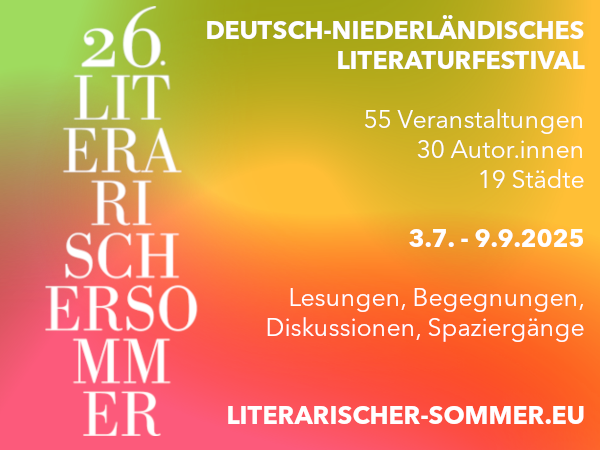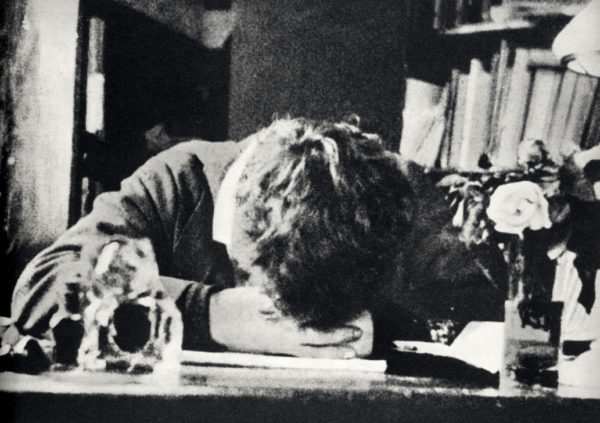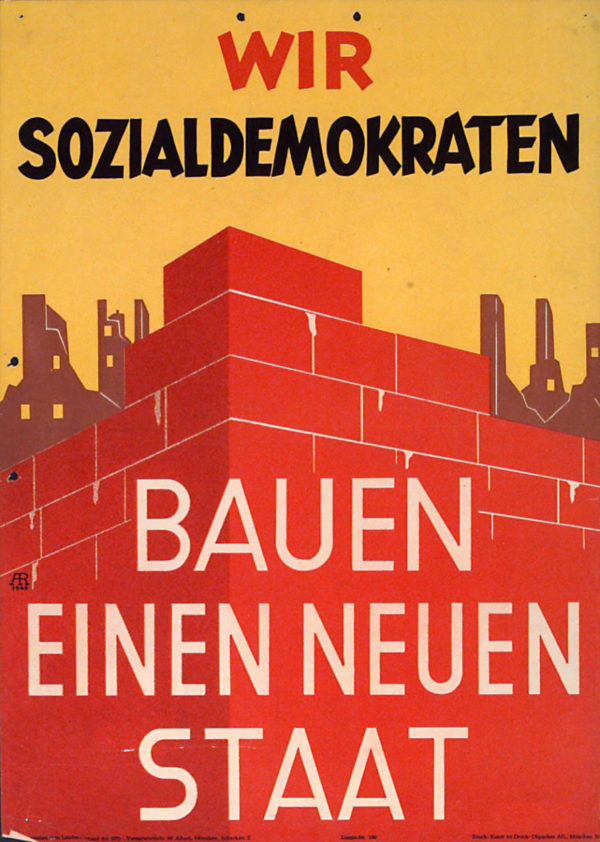kultur.west:
Frau
Schwedler, wie wird man Trauerrednerin?
Beate
Schwedler:
Ich bin von Beruf Journalistin, ich habe für Zeitungen, das
Lokalradio und später für Werbeagenturen gearbeitet. Als ich 42
war, ist mein Lebensgefährte an Krebs erkrankt. Ich stand völlig
unvorbereitet vor dieser Situation mit Pflege, Krankenhaus und alles
was da dranhängt. Ich habe das komplett miterlebt bis zum Hospiz am
Schluss; auch bei seinem Tod war ich dabei. Einige Wochen später ist
dann meine Schwester an Krebs erkrankt. Da habe ich nochmal das
Gleiche erlebt, zum zweiten Mal in einem Jahr. Das hat dann eine
Menge verändert. Das war ein längerer Prozess, über einige Jahre,
die mich persönlich auch verändert haben. Als mein Sohn
selbstständig wurde, war ich Anfang Fünfzig und habe mich
entschieden, nochmal etwas zu ändern. Ich wollte gerne persönlicher
und näher am Menschen arbeiten. Ich hatte viele Ideen, und eine
davon war, eben gute Trauerreden zu schreiben und zu halten.
kultur.west:
Weil sie genug
schlechte Reden gehört hatten?
Beate
Schwedler: Bei
meinen Lieben war es so, dass beide aus der Kirche ausgetreten waren
und dementsprechend freie Redner die Beerdigungen gestaltet haben.
Einmal war es besser und einmal war es nicht so gut. Da merkte ich
schon, wie wichtig eine gute Rede ist.
kultur.west:
Wie arbeiten sie?
Kommen die Angehörigen direkt auf sie zu?
Beate
Schwedler: Ich
gehe direkt zu Bestattern, stelle mich vor und die Bestatter
empfehlen mich dann. Es gibt ja auch den Humanistischen Verband, das
ist die säkulare Alternative zu den Kirchen, der in NRW Trauerreden
vermittelt. Mich stört daran, dass bei einem Pastor in der Rede Gott
auftauchen muss und beim Verband darf Gott keine Rolle spielen. So
etwas entspricht nicht meiner Idee von Trauerreden. Ich versuche,
diese an den Verstorbenen oder den Angehörigen auszurichten. Es geht
nicht um meine Weltanschauung, sondern um die Menschen. Ich frage die
Angehörigen, ob die Person an Gott geglaubt hat. Es gibt ja genug
Leute, die zwar nicht in der Kirche sind, das aber trotzdem tun. Oder
im Alter, wenn es ans Sterben geht, zu beten anfangen oder den
Gedanken tröstlich finden, dass man sich nach dem Tod wiedersieht.
Ich schreibe dann die Rede, mache mir Gedanken über die Musik und
bespreche kleine Rituale.
kultur.west:
Sie schreiben auf
Ihrer Webseite, dass »Rituale
die Brücke zwischen den Lebensabschnitten«
bilden.
Beate
Schwedler: Die
Trauerfeier selbst ist ein Ritual. In diesen Ablauf kann man auch
eigene Dinge einbringen, indem man etwa dem Toten etwas mit auf den
Weg gibt. Das reicht von der Enkelin, die mit Oma immer was gebastelt
hat, die dann ein Fläschchen mit Glitzerpulver mitbringt, sich vor
das Urnengrab hockt und ein bisschen davon hinein streut, bis zu
einem Brief, einem gemalten Bild oder einem persönlichen Gegenstand.
Das ist auch für die Hinterbliebenen eine tröstliche Sache.
kultur.west:
Wie nimmt man
richtig Abschied?
Beate
Schwedler: Da
gibt es kein Patentrezept. Dafür sind die Menschen zu
unterschiedlich. Ich würde sagen, man nimmt nicht Abschied. Wenn
einem der Verstorbene nicht besonders nahestand, etwa ein entfernter
Nachbar, den man sowieso nicht oft gesehen hat, ist der zwar nicht
mehr da, das fällt aber auch nicht so auf. Aber je näher jemand
einem kommt, den man wirklich geliebt hat oder der ein wichtiger
Mensch war, dann gibt es keinen Abschied. Es gibt nur einen Abschied
vom Körper, vom körperlichen Zusammensein. Man kann sich nicht mehr
in die Augen schauen, nicht mehr an einem Tisch sitzen. Das ist schon
schlimm genug. Aber Abschied von dem Menschen gibt es eigentlich
nicht, finde ich. Wen man geliebt hat, den hat man immer bei sich. In
der Trauergruppe, die ich gegründet habe, ist es allen ganz
wichtig, dass normal über den Angehörigen gesprochen wird. Dass er
auf diese Weise am Leben gehalten bleibt und dass man ihn nicht
vergisst. Abschied ist ja das, was man gar nicht will. Die andere
Frage ist, wie man danach weiterlebt. Wie baue ich mein Leben auf,
nachdem jemand gestorben ist, der mir ganz wichtig ist? Wie komme ich
jetzt alleine zurecht? Ohne meinen Ehepartner? Oder ohne mein Kind?
kultur.west:
Wie
lange braucht man
dafür? Hat man irgendwann genug getrauert?
Beate
Schwedler: Nein. Das
ist bei jedem anders. Es gibt diese merkwürdigen Studien, die
behaupten, wenn man mehr als sechs Wochen trauert, ist es chronisch.
Hanebüchen – wo leben die denn? Das kann man nicht generell sagen.
Bei manchen in meiner Trauergruppe ist es gerade mal drei Monate her,
bei anderen schon anderthalb Jahre. Das erste Jahr ist immer heftig.
Früher gab es das Trauerjahr, in dem man schwarze Kleidung trug.
Das ist schon ein interessanter Zeitraum, wenn man große
Veränderungen zu bewältigen hat. Ein Jahr – einmal Ostern, einmal
Weihnachten, einmal Geburtstag ohne den Verstorbenen – dann hat man
alles zum ersten Mal in der veränderten Situation erlebt. Ich finde,
das war ein sinnvolles Ritual. Schade, dass wir das immer weniger
haben. Im zweiten Jahr ist dann schon einiges anders. Aber manchmal
begreift man erst dann tiefgreifend, dass der Andere nicht mehr da
ist und man schauen muss, wie man sein Leben neu organisiert. Das ist
der Schub hinterher.
kultur.west:
Muss
man irgendwann ganz loslassen?
Beate
Schwedler: Warum
sollte man? Menschen sind verschieden. Die
einen räumen am ersten Tag alles weg, weil sie es nicht ertragen
können, die anderen bauen sich einen Altar aus Erinnerungsstücken.
Ich glaube, das ist alles in Ordnung, das sollte man nicht von außen
bewerten. Dieses Loslassen ist ja auch mit der Frage verbunden, wie
das eigentlich »richtig« gehen soll. Lieber hält man etwas fest.
Von der Hamburgerin Anemone Ziem, die »Vergiss Mein Nie«, ein
Geschäft für Trauerbegleitung, eröffnet hat, stammt der Satz:
»Wenn ich etwas zum festhalten habe, kann ich auch leichter
loslassen.« Das kann vieles sein. Eben etwas, das ich anfassen kann,
das immer bei mir ist. Dann kann das Loslassen weitergehen.
Beate Schwedler ist gelernte Journalistin und arbeitet heute als freie Trauerrednerin. Zudem hat die 58-jährige Dortmunderin den Verein »Forum Dunkelbunt – Lasst uns reden … über das Sterben, den Tod, die Trauer e.V.« sowie den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst »Löwenzahn« mitgegründet.