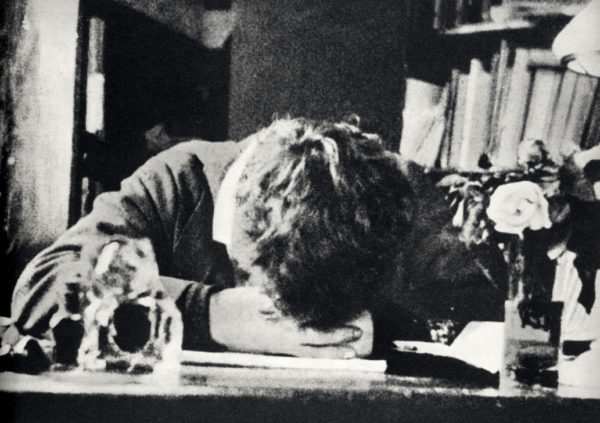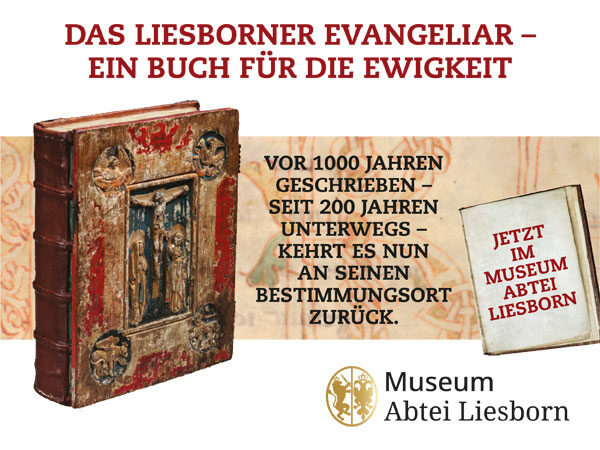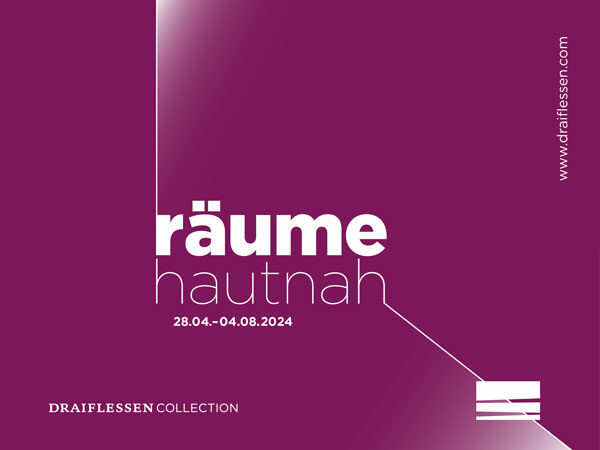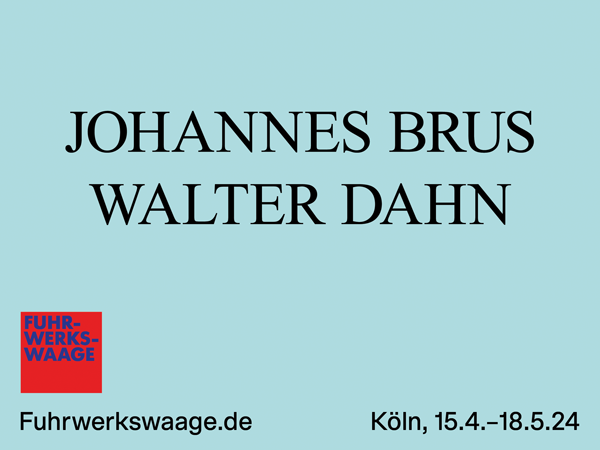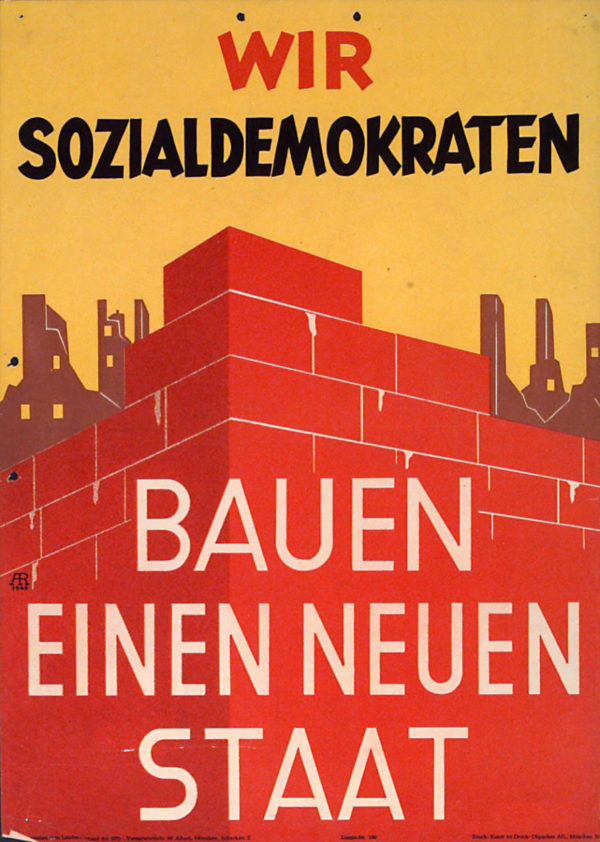kultur.west:
Frau Bobe, was ist Prokrastination? Krankheit, psychische Störung
oder lediglich eine Modeerscheinung?
JULIA BOBE: Im Grunde ist sie erst einmal eine bestimmte Form des Aufschiebens. Die Beschreibung des Phänomens, dass man freiwillig Dinge und Projekte, die man sich eigentlich vorgenommen hat zu tun, aufschiebt. Ohne dass äußere Umstände dazu beigetragen haben. Das hat negative Konsequenzen, man hat dementsprechend nicht das Ziel erreicht, was man gern erreichen würde. Oder zögert alles bis zur Deadline heraus. Das kann durchaus so drastisch werden, dass es in einer psychischen Störung mündet. Es kommt aber auch darauf an, wen sie fragen. Die einen sagen, ja, es ist eine psychische Störung und als »Arbeitsstörung« definiert. Die anderen, es sei nur ein Symptom, einhergehend mit Angststörungen oder Depressionen – wenn man ängstlich oder depressiv ist, würde man demnach häufiger prokrastinieren. Eine Modeerscheinung ist die Prokrastination nicht, da schon alte Schriften von diesem Phänomen berichten. Eine Modeerscheinung ist sie dann, wenn im Zuge der zunehmenden Selbstoptimierung viele Ratgeber zum Thema erscheinen und viele Menschen sich dann die Frage stellen, ob sie selbst betroffen sind.
kultur.west:
Wie sehen die Symptome aus?
BOBE:
Auch das ist erst mal eine subjektive Einschätzung des eigenen
Verhaltens. Sobald aber ein Leidensdruck entsteht und ich merke, dass
ich immer unter meinen Möglichkeiten bleibe, dass ich bereits
negative Konsequenzen in der Arbeitswelt erfahren habe, oder ich im
Freundeskreis darauf angesprochen werde und es mich selber stört.
Wenn ich das darauf zurückführe, dass ich Sachen nicht zu Ende
erledige oder zu spät damit beginne, dann lohnt es, sich die Frage
zu stellen, wo das Problem liegt und wie man dagegen angehen kann.
Dafür gibt es zum Beispiel spezielle Fragebögen, die helfen sollen,
das selber einschätzen zu können. Es gibt aber durchaus Menschen,
die damit überhaupt kein Problem haben und wenig selbstkritisch
sind. Die kommen eben mal zu spät oder geben ihre Steuererklärung
erst auf den letzten Drücker ab, aber empfinden das selbst nicht als
kritisch.
kultur.west:
Stimmt es, dass oft Student*innen und Kreative betroffen sind?
BOBE:
Da muss man unterscheiden, was Prokrastination wahrscheinlich macht.
Das sind erst mal Faktoren, die innerhalb der Person liegen. Dass man
etwa impulsiv ist oder durch eine geringe Stressresistenz dafür
anfällig, Dinge aufzuschieben. Ich denke bei Ihrer Frage eher an die
situationsspezifischen Kriterien, also welche Aufgaben dafür
prädestiniert sind, dass man sie aufschiebt. Das ist durchaus in
manchen Berufsfeldern oder Lebensphasen häufiger der Fall. Deswegen
leiden auch so häufig Studierende darunter, weil es eben nicht mehr
die klaren Regeln wie in der Schule gibt, sondern viel mehr
Selbstverantwortung. Bei Künstler*innen sind viele selbstständig
und müssen sich selbst organisieren. Das könnte verstärkt dazu
führen, dass diese Menschen mehr prädestiniert für das Aufschieben
sind als andere.

Foto: Universität Paderborn
kulturwest:
Wo setzen Sie für die Betroffenen mit Ihrer Beratungsstelle an?
BOBE:Wir
bieten verschiedene Angebote an. Einige sind niedrigschwellig in Form
von Vorträgen oder kurzen Workshops. Es gibt aber auch feste Gruppe
von Studierenden, die sich
wöchentlich
treffen und über ihren Alltag sprechen. Wir setzen auf kurzfristige
Impulse und langfristige Begleitung durchs Studium. Inhaltlich gibt
es verschiedene Ansätze: Etwa den der Prokrastinations-Ambulanz der
Uni Münster, deren Programm eher kognitiv-verhaltenstherapeutisch
ausgerichtet ist, mit dem wir ebenfalls arbeiten. Da schauen wir,
welche Gedanken bei den Betroffenen zu Prokrastination führen,
welche Verhaltensweisen sie ändern und wie sie an ihrer Motivation
arbeiten können. In unserer Anti-Prokrastinationsgruppe geht es eher
darum, die Ressourcen, also die Dinge, die schon da sind und gut
laufen, zu aktivieren und im Austausch mit anderen darüber zu
sprechen, welche Strategien individuell helfen können. Ziel ist,
dass weniger Leidensdruck erzeugt wird und man mehr Sachen schafft,
die man sich vorgenommen hat.
kultur.west:
Was wünschen Sie sich für den Umgang mit der Prokrastination?
BOBE:Wir
als Team sehen es sehr kritisch, dass es immer mehr darum geht, sich
selbst zu optimieren, effizienter zu werden, alles zu erledigen, was
man sich vornimmt zu tun. Es wäre schöner, wenn der Diskurs mehr in
die Richtung gehen würde, was wirklich wichtig ist. Dass man die
organisatorischen Nichtigkeiten, in die man sich verstrickt, einfach
mal zur Seite schiebt mit der Erkenntnis, dass man sich das zwar
vorgenommen hat, aber nun guten Gewissens nicht weiterverfolgt. Und
damit seinen Frieden macht.
Julia Bobe ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Psychologie an der Universität Paderborn und Teil des Teams der Beratungsstelle »ProLernen«