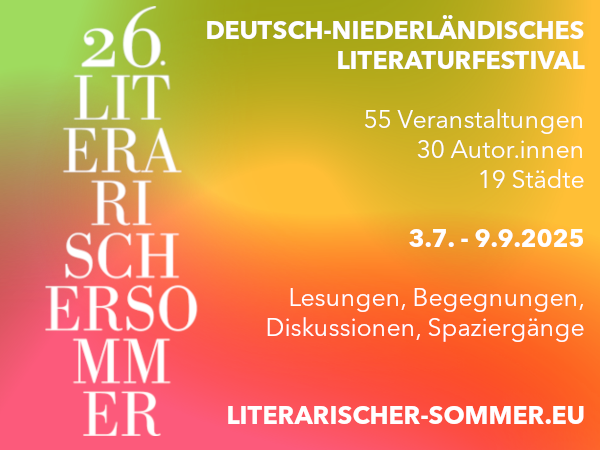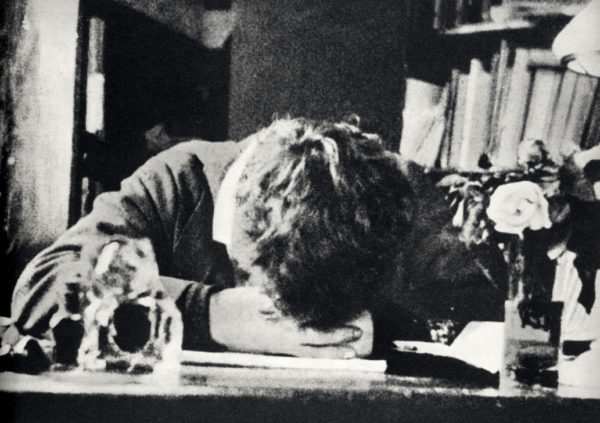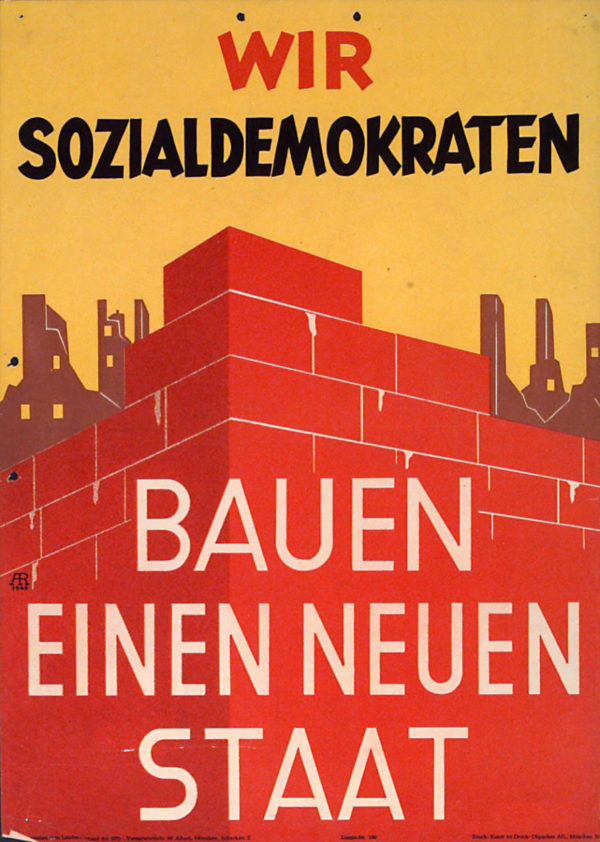kultur.west: Herr Deeg, welche Rolle spielt Spaß in der Kulturvermittlung?
DEEG:
Spaß wird – insbesondere in Deutschland – immer gleichgesetzt
mit Unseriösität und Trivialisierung, was natürlich Unsinn ist.
Gerade das Spiel ist eines der komplexesten Systeme und das genaue
Gegenteil von Verflachung. Es gibt kein Gesetz auf der Welt, dass
besagt, dass wir einem jungen Menschen spielerisch Dinge vermitteln
und wenn er dann erwachsen ist, muss er aufhören, zu spielen. Spiel
heißt ja auch einfach, Dinge neu zu sehen – und darum geht es im
Kern ja im Kultursektor.
kultur.west:
Was ist eigentlich Gamification genau und was kann sie im
Kulturbereich bringen?
DEEG:
In der reinen Gamification geht es darum, dass wir real existierende
Prozesse aus dem Kulturbereich nehmen, beispielsweise einen
Museumsbesuch, eine Führung oder einen Theaterbesuch und versuchen,
durch Spielelemente das Erlebnis und den Erfahrungsraum zu erweitern
und noch menschlicher zu gestalten. Daneben gibt es weitere Bereiche,
wie etwa die sogenannte »Playful Participation«.
kultur.west:
Haben sie ein aktuelles Beispiel?
DEEG:
Ich habe mit der Volkshochschule in Neuss im Rahmen von »Kultur
macht stark« das Projekt »The Shakespeare Game« realisiert. Da
ging es darum, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund dazu
gebracht werden sollen, sich mit Shakespeare auseinanderzusetzen. Die
Jugendlichen haben sich daraufhin die Story ausgedacht, dass in der
Bibliothek die Bücher aus dem Regal fallen, die Figuren daraus
hervor kommen und ihrem Ärger über den Autor Luft machen, weil sie
keine Lust mehr haben, alle sterben zu müssen. Daraufhin beschließen
sie, Shakespeare zu suchen und zur Rede zu stellen. Diesen Plot haben
sie dann in einem »Localbase Game« umgesetzt. Das heißt: Die
Spieler haben mit einer App bestimmte Orte in der Stadt aufgesucht,
wo sie dann Rätsel lösen mussten oder Fragen beantworteten.
kultur.west:
Hat das Projekt denn dazu geführt, dass sich die Jugendlichen
tatsächlich weiter mit Shakespeare beschäftigen?
DEEG:
Für die Teilnehmer war es wichtig, dass sie ihren eigenen Zugang zum
Thema finden konnten. Was Spielmodelle dabei leisten können ist,
dass ich aus den Erfahrungen anderer, also Shakespeare, meine eigenen
machen kann. Ich hätte mir im Anschluss natürlich weitere
Aktivitäten und die Einbindung in ein langfristiges Konzept
gewünscht, aber da sind die Kulturinstitutionen oft noch nicht so
weit.

kultur.west:
Und wie hilft die Universalität des Spiels den Kulturinstitutionen?
DEEG:
Nehmen wir eine Führung im Museum. Was passiert, wenn wir das
Motivationsportfolio, wie wir es aus dem Spiel kennen, zugrunde
legen? Motivation kann sein: Ich möchte etwas mit anderen zusammen
tun, ich möchte Teil von etwas Größerem sein, ich möchte mich
verbessern, ich möchte meine Neugierde befriedigen, ich möchte
überrascht werden, ich suche den Wettbewerb. Das sind Muster, die
man alle sehr gut beim Spielen beobachten kann und aus denen sich
jeder ein individuelles Motivationsportfolio zusammenstellt. Wenn wir
uns daraufhin die bestehenden Kulturvermittlungsangebote anschauen,
stellen wir fest, dass viele von diesen Punkten gar nicht getriggert
werden.
kultur.west:
Was ist denn das Spezielle an Spielmodellen oder Spielen überhaupt
– was macht sie interessant?
DEEG:
Wenn wir das Spiel als Kunstform begreifen, dann ist es eine, die
sich tatsächlich erst in der Anwendung realisiert. Teilweise finden
Sie das auch schon in der Medien-Kunst, aber nicht in der Konsequenz
eines Videospiels. Das bedeutet auch, dass dem Spiel Mechanismen
zugrunde liegen, die den Spieler dazu bringen müssen, das Spiel aus
eigener Motivation tatsächlich zu spielen und zwar bis zum Ende.
kultur.west:
Könnten diese Mechanismen also den Besucher eines Museums dazu
bringen, sich die gesamte Ausstellung anzuschauen und nicht nach der
Hälfte das Interesse zu verlieren?
DEEG:
Ja, ganz genau. Exakt um diese Effekte geht es bei der Gamification
im Kultursektor. Wir müssen alles, was wir im Museum haben, noch
einmal überdenken und überlegen, wie können Spielmechaniken dazu
führen, nicht nur, dass Besucher sich eine Ausstellung bis zum Ende
anschauen. Sondern dass sich auch die Menschen, die noch nicht ins
Museum gehen, für die eine oder andere Ausstellung interessieren.
kultur.west:
Es geht also um neue Zielgruppen?
DEEG:
Mit Zielgruppen versucht man Stereotypen zu erzeugen. Eigentlich
müsste man sich aber den einzelnen Menschen anschauen. Die
Zielgruppe versucht den individuellen Menschen in ein Schema zu
pressen. Das funktioniert aber nur begrenzt. Es fehlt der Blick auf
die Motivation des einzelnen, sich mit etwas zu beschäftigen. Das
Spiel ist da universeller, auch unabhängig von Kulturräumen zum
Beispiel. Ich kann mit jedem Menschen auf der Welt spielen, völlig
unabhängig von seinem kulturellem Hintergrund, seinem Geschlecht
oder seiner Bildung.
Der
45-jährige Christoph Deeg studierte in Leipzig Jazz-Schlagzeug,
leitete einen Plattenladen, betreute bei »Disney« den Aufbau der
Computerspiel-Sparte und arbeitet heute als Experte für
»Gamification« im Kulturbereich. In NRW setzte er das Konzept
»Lernort Bibliothek« um. Zudem hilft er weltweit, Spielmechanismen
in die Kulturvermittlung zu integrieren – etwa durch Projekte
mit dem Goethe-Institut.