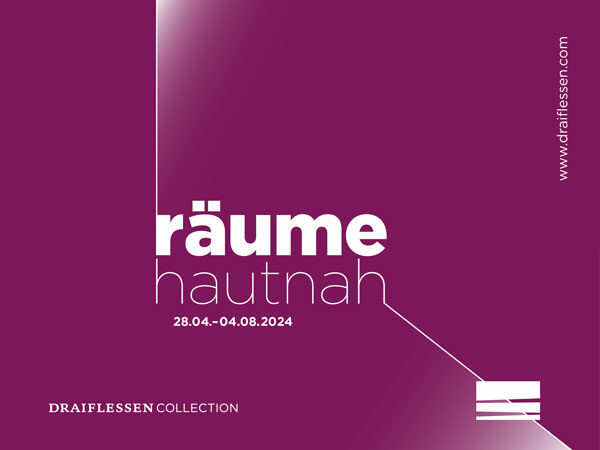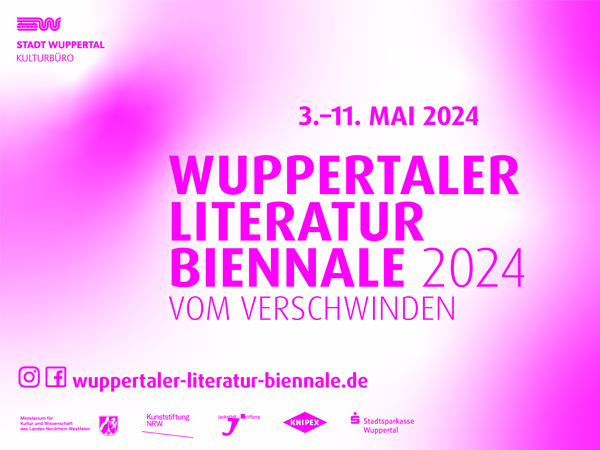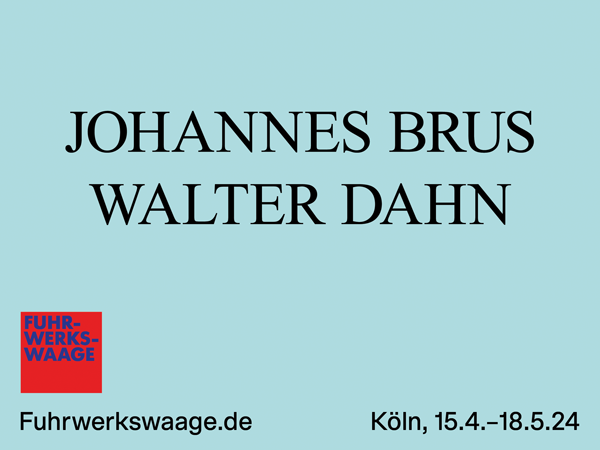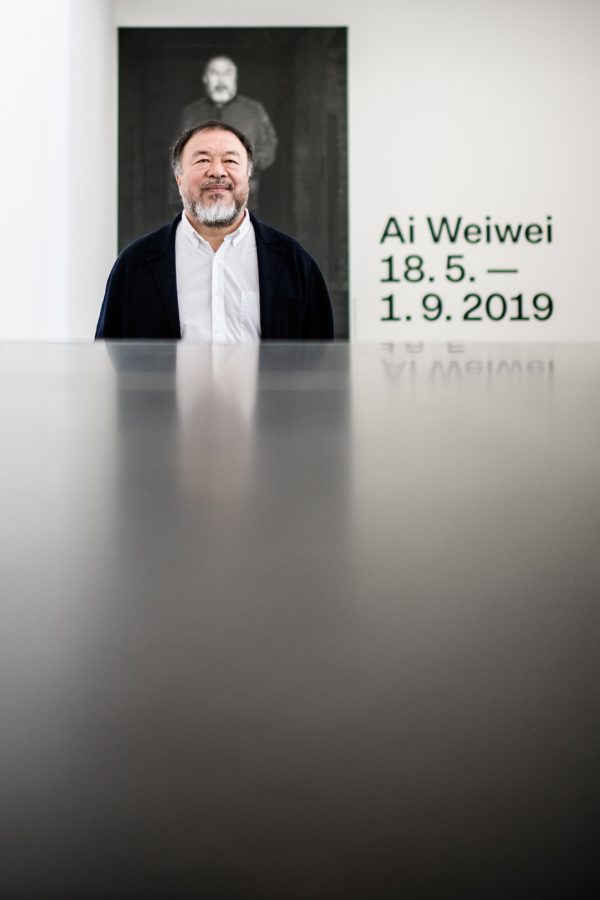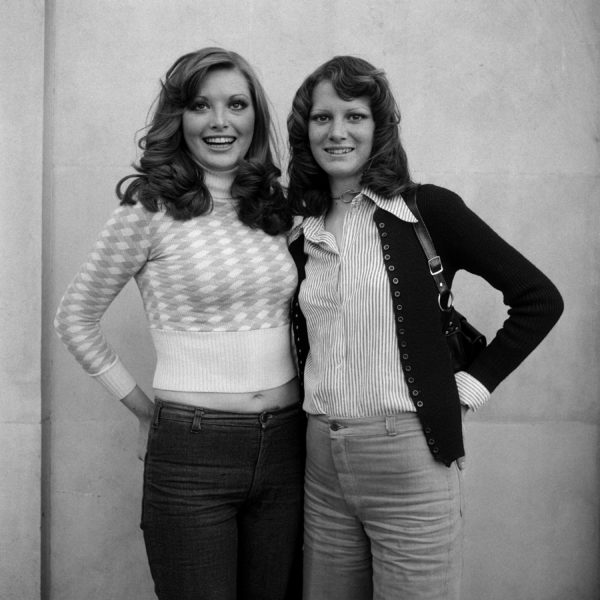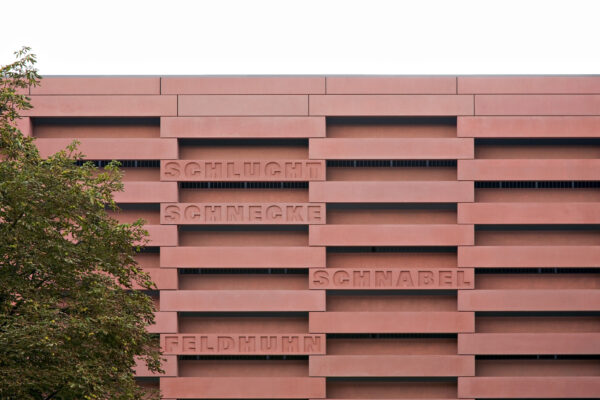Pop-Pfarrer.
Kultur-Pfarrer. Beschäftigt man sich etwas mit dem Leben von
Thorsten Nolting, stößt man schnell auf diese Etiketten, oder
spitzer formuliert – Schubladen. »Ich weiß nicht. Das passt gar
nicht richtig zu mir« sagt Thorsten Nolting. »Bei mir gab es eine
Verschiebung in der Rolle. Ich hatte meine kulturell geprägte Zeit
als Pfarrer der Johanneskirche. Acht Jahre, die für mich sehr
intensiv waren, dort habe ich bestimmte Muster aufgebaut und danach
weitergeführt und mit meiner neuen Aufgabe bei der Diakonie
fusioniert. Ich habe das Alte nicht ganz gelassen, sondern habe etwas
davon mitgenommen und versucht, diese Mischung aus Religion und Kunst
auch im Feld des Sozialen anzuwenden.«
Nolting
sitzt in seinem Büro auf dem Diakonie-Campus in Düsseldorf-Flingern.
Von dort aus blickt man auf den offenen Platz, um den sich ein
Pflegeheim, Beratungsstellen, ein Sozial-Kaufhaus, Frisörsalon, das
niedrigschwellige Suchthilfe-Café »Drrüsch« sowie der große,
helle Raum der Versöhnungskirche mit der Engel-Skulptur des
Künstlers Thomas Schütte gruppieren. Nolting ist nicht nur der
Diakoniepfarrer, sondern auch der Vorstandsvorsitzende der Diakonie,
ist somit für die ganze Stadt und 3000 Mitarbeiter*innen zuständig,
von der Kita bis zum Pflegeheim.
Die leere Bergerkirche als Raum für Experimente
Jene Etiketten, mit denen Nolting wenig anfangen kann, haben ihre Wurzeln in den 2000er Jahren. Damals beauftragte er den Künstler Tobias Rehberger, die Bergerkirche in der Düsseldorfer Altstadt neu zu gestalten. Aus dem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das versteckt in einem Innenhof liegt, wurde ein offener moderner Raum mit grünen Wänden, einem weiß illuminierten Altarblock, einer asymmetrisch gehängten, roten Kugelleuchte; bewusst konfessionsübergreifend gestaltet: »Das wollte ich unbedingt, wir haben ja auch bei der Diakonie verschiedenste Konfessionen. Was uns interessiert, ist die Haltung. Wie geht man auf andere zu, wo sind aber auch gemeinsame Grenzen?« Die Kirche wurde zum Raum für Experimente, zum »Labor für soziale und ästethische Entwicklung«, was auch durch die Plakate des Kommunikationdesigners Fons Hickmann für Aufmerksamkeit in der Kunst- und Kulturszene sorgte. 2013 gründete Nolting dort das »Büro für soziale Innovation«, das sich mit neuen Ansätzen für Soziale Arbeit und die damit verbundenen Folgen für die Diakonie beschäftigt. In Zusammenarbeit mit sozialen Unternehmern und Social Start-Ups geht es um digital health, digitale Suchtprävention und neuen Methoden der Jugend- und Familienarbeit. Das Gesprächsformat »futuro sociale« bindet die interessierte Öffentlichkeit mit ein.

»Uns
interessiert, ob dieses Label ›futuro
sociale‹
irgendetwas auslösen kann« sagt Thorsten Nolting. »Die
Veranstaltungen sind sehr gemischt, nicht jedes Gespräch und jede
Aktion sind folgenreich, aber manches hat schon eine Wirkung.
Dahinter gibt es eine Art verborgene Werkstatt, wo wir als Diakonie
im Kontakt stehen mit Social Start-Ups, die interessante Ideen haben,
aber oft nicht die finanziellen Mittel, diese umzusetzen. Das ist,
das was darunter liegt. Was wir immer wieder zeigen, sind bestimmte
Themen, von denen wir glauben, dass diese auch die Bevölkerung
beschäftigen.« Ihm geht es dabei aber nicht darum, eine weitere
Talkshow zu inszenieren. »Ich lege großen Wert darauf, dass das
Format nicht konfrontativ ist, weil mich das so langweilt. Statt
harter Gegenmeinungen möchte ich etwas für die Zukunft konstruieren
und mit Leuten reden, die daran mitdenken.« Das überträgt sich
dann im besten Fall auch auf das Publikum, dass sich am Gespräch
beteiligt. Zudem hat Nolting einen Architekten beauftragt, ein
Büdchen vor der Kirche zu konstruieren, aus dem man einen Tresen
hervorziehen kann. »Das ist sehr kommunikativ, da bleiben Leute auch
schon mal eine Stunde länger und reden miteinander. Das ist wichtig
– die Leute in Kontakt zu bringen!«
Überhaupt
liegt ihm viel an der Förderung von Kommunikationskultur zwischen
der Kirche, den Mitarbeiter*innen und der Gesellschaft. Auch die
Atmosphäre und die Gestaltung der Orte sei dabei wichtig. »Moment.«
Nolting steht auf, holt ein Buch aus dem Regal, blättert, findet und
zeigt ein Foto eines modernen Gebäudes mit raffinierten
Fensterflächen: »Das ist unser neuer Campus mit dem
Fortbildungsinstitut in Holthausen. Vorne ist das Institut, daneben
ist eine Kita. Das macht Spaß! So wollen wir Kultur und
Wertschätzung an die Mitarbeitenden zu vermitteln. In einer
Architektur, die sich sehen lassen kann und nicht protzig ist.« Und
erzählt begeistert von einem neuen Pflegeheim mit einem besonderen
Raum der Stille, der vom Düsseldorfer Künstler Markus Karstieß
gestaltet wurde; für das Personal und die Angehörigen. »Für
solche Zwecke ist Kunst einfach fantastisch!«
Diesen
Dialog soll auch ein neues Magazin gleichen Namens vermitteln, das
optisch und inhaltlich meilenweit entfernt ist von den üblichen
Kirchenmitteilungsblättchen. Die erste Ausgabe mit dem Thema
»Einsamkeit?« hat zwei aufeinandergestapelte, pittoresk
angeschrammte Plastikgartenstühle auf dem Cover. »So versuchen wir,
relevante gesellschaftliche Themen mit der Kunst zu verbinden« sagt
Nolting und blättert durch die Seiten. »Ich habe Ann-Christin
Bertrand von C/O Berlin gebeten, diese erste Foto-Strecke und den
Titel zu kuratieren. Beim zweiten Heft macht das Thomas Seelig, der
Leiter der fotografischen Sammlung im Museum Folkwang.«

Mit
dem Begriff »Social Design« kann Nolting hingegen wenig anfangen –
»Schwierig, damit meint man meist die Frage, wieviel Bänke auf
einem Platz stehen sollen« – mit Social Start-Ups um so mehr.
Dennoch müsse man sich eins klarmachen: »Es ist noch wahnsinnig
schwer, damit in Deutschland Geld zu verdienen. Wenn jetzt jemand
etwas erfindet, um etwa Zimmer an Flüchtende zu vermitteln, wer soll
das bezahlen? Dafür haben wir kein Geld, heißt es dann.« In Wien
hat so etwas hingegen hervorragend funktioniert, schwärmt Nolting
und erzählt vom »Magdas« – einem Hotel, das fast nur von
Geflüchteten betrieben wird, was hervorragend zum internationalen
Publikum passt. »Es gibt interessante Sachen. Und es lohnt sich,
diese zu bestärken.« Deshalb investieren Nolting und die Diakonie
ins Digitale, etwa
im Bereich des Kontaktes zu den Familien von Kindern, die
Schwierigkeiten haben. »Dieser
Kontakt zu den Eltern fällt uns oft schwer«
sagt Thorsten Nolting. »Weil
die Eltern teils ebenfalls unzuverlässig sind. Wir brauchen die
Eltern, damit für das Kind etwas besser wird. Das geht am besten mit
dem Mobiltelefon. Mit einem kleinen Start-Up gehen wir jetzt in die
Software-Entwicklung und planen zum Beispiel Chats und
Terminvereinbarungen mit den Eltern über eine App.«
»Ich habe den Glauben immer als etwas empfunden, das mich bestärkt, im anderen etwas Gutes zu sehen«
Man
spürt im Gespräch, dass Nolting eher die Chancen als Risiken sieht
– sei es im Umgang mit der Technologie oder mit den Menschen. »Ich
habe den Glauben immer als etwas empfunden, das mich bestärkt, im
anderen etwas Gutes zu sehen«
sagt Nolting und lächelt. »Mehr
die Begabung, mehr das Positive als das Defizit. Das ist für mich
das christliche Menschenbild. Das ist ein bisschen verschüttet durch
diese ganze Sünden-Thematik! Da hat die Kirche ziemlichen Mist
gebaut, weil sie das so stark gemacht hat über die Jahrhunderte. Für
mich ist der Kern ein ganz anderer. Nämlich aus diesem Defizitdenken
herauszukommen, auch bei sich selber. Der Glaube an Gott hat immer
diesen Teil, dass man einverstanden ist mit sich. So eine
Grundbestätigung trotz aller Fehler, um damit durch die Welt zu
gehen, die finde ich enorm wichtig.«
Die
Menschen wieder für die Kirche und den Glauben begeistern. Mit
ungewöhnlichen Formaten, wie damals und heute in der Bergerkirche.
Oder jener performativen Konzertreihe »Gospeltainment«,
mit der er drei Jahre der Johanneskirche volles Haus beschert hat.
Danach kamen viele Besucher auf ihn zu und wollten in die Kirche
eintreten. »Ja,
das war sehr erfolgreich« lacht Nolting. »Wir haben dann dort die
zentrale Wiedereintrittssstelle gegründet, die erste hier im
Rheinland. Wir hatten im ersten Jahr etwa 150 Eintritte, da war ich
ganz stolz. Aber dieses Potential, was da ist, haben wir noch lange
nicht ausgeschöpft, da ist viel mehr möglich.
Wir
müssen neue Formen bauen. Wir können kaum etwas so lassen.«