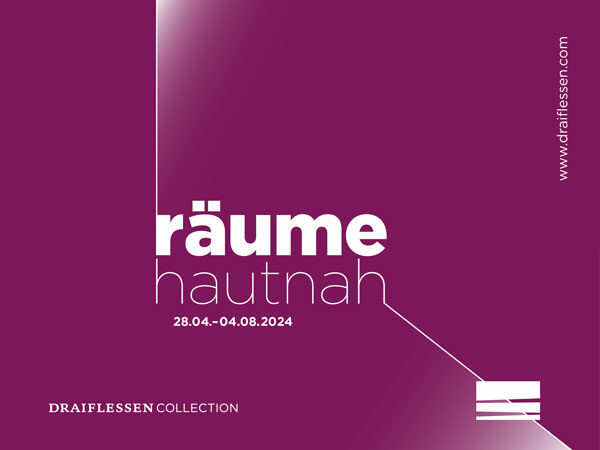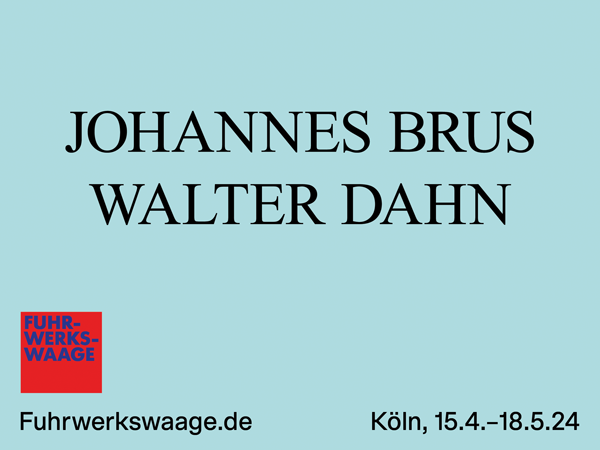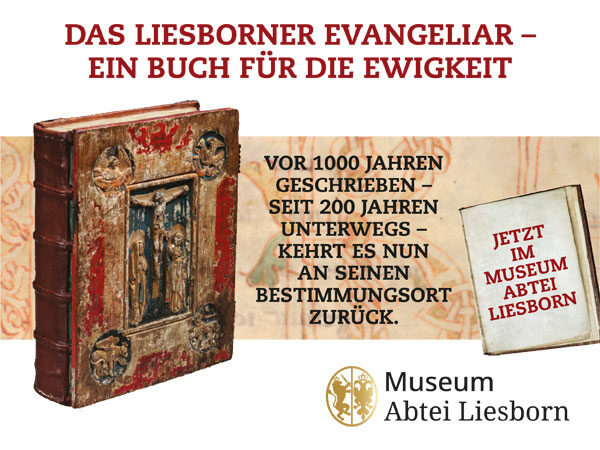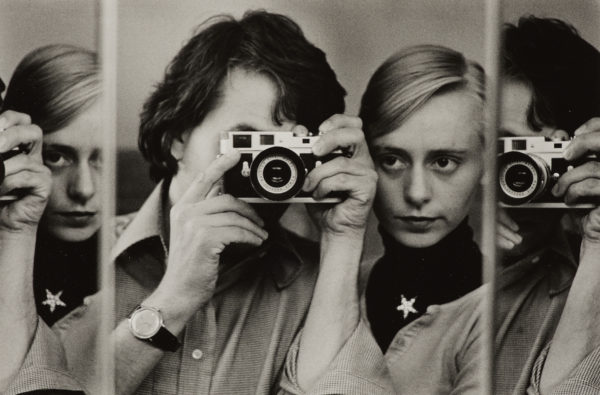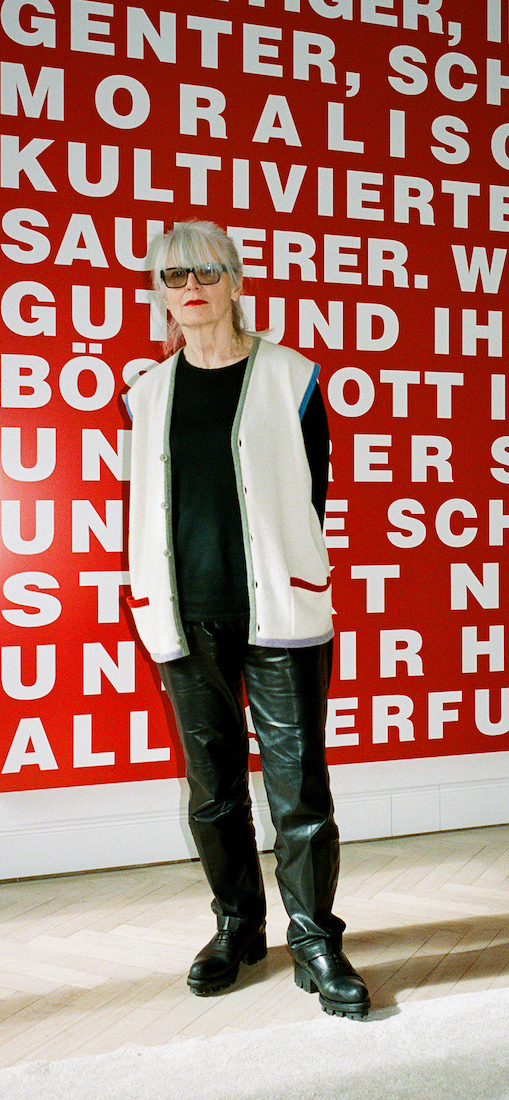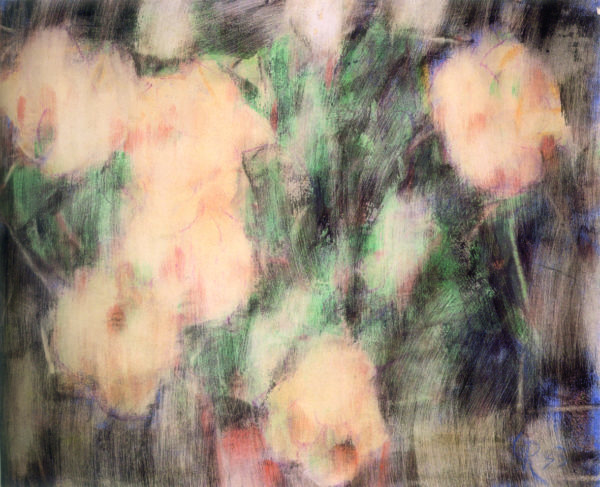kultur.west:
Frau Peters, wie kamen Sie auf den Begriff »Ruhr Ding«?
PETERS:
Der Begriff »Ding« hat für uns mehrere Anknüpfungspunkte.
Einerseits in der Museologie, also als der Gegenstand, den man
anfassen, sehen und beschreiben kann, andererseits natürlich als
philosophischer Begriff bei Heidegger, Kant oder Benjamin und dann
auch noch in der Ethymologie als der Ting Platz. Das ist zwar ein von
den Rechten leider missbrauchter Begriff, aber im Sinn von
öffentlichem Versammlungsplatz für uns auch wichtig.
kultur.west:
Sie haben einmal gesagt, dass sie von außen betrachtet das Programm
von Urbane Künste Ruhr immer interessant, aber als manchmal
unübersichtlich empfunden haben.
PETERS:
Ich fand viele Projekte spannend, aber habe oft nicht so richtig
verstanden, wie das alles zusammenkommt. Da gab es diese mehrjährigen
Programme mit einer einheitlichen Überschrift, aber in der reinen
Außenperspektive habe ich das oft als etwas diffus wahrgenommen.
kultur.west:
Machen Sie es jetzt den Besucher*innen leichter?
PETERS:
Von Hause aus bin ich Ausstellungsmacherin. Das heißt, es geht mir
immer darum, unterschiedliche künstlerische Perspektiven zueinander
in Beziehung zu setzen. Also nicht das eine Projekt alleine zu sehen,
sondern dialektische Sichtweisen zuzulassen und aus der
Unterschiedlichkeit der künstlerischen Positionen einen Mehrwert
entstehen zu lassen. Dafür haben wir alles im »Ruhr Ding«
zumindest zeitlich gebündelt. So haben die Besucher*innen, egal ob
sie nun aus der Region oder von außerhalb kommen, die Möglichkeit,
alle Positionen nebeneinander zu erleben und die Kontraste zwischen
den Arbeiten direkt zu erfahren.
kultur.west:
Ist das »Ruhr Ding« also eine echte Ausstellung?
PETERS:
Es ist ein Ausstellungsformat und es unterscheidet sich
beispielsweise von einem Festival ganz deutlich durch die großzügigen
Öffnungszeiten, die über zwei Monate bis auf montags täglich acht
manchmal sogar zehn Stunden betragen. So dass der Besuch gerade von
Menschen aus der Region zeitlich versetzt stattfinden kann – alles
ist ohnehin kaum an einem Tag zu schaffen. Außerdem gibt es dadurch
auch die Möglichkeit, Arbeiten, die einem besonders gut gefallen,
mehrfach zu erleben, vielleicht auch mit Freunden oder Kollegen, und
sich darüber auch selber im Gespräch etwas zu vermitteln. Einige
Arbeiten, wie etwa die von Suse Wächter, bei der performative
Elemente und das Entstehen während der Ausstellungsdauer wichtig
sind, verändern sich auch laufend.
kultur.west:
Wie spiegelt sich Ihr Ansatz in der Auswahl der Künstler und
Arbeiten wieder?
PETERS:
Die Arbeiten sind sicherlich weniger prozesshaft, als das bisher bei
Urbane Künste Ruhr oft der Fall war. Es geht mir darum, die Stimmen
der Künstler*innen zu hören und dem Raum zu geben. Also die
künstlerische Stimme als Alternative zu Sprache oder Text. Jenseits
der Bezüge, die eine Gruppenausstellung herstellt, hat jede einzelne
Arbeit eine Kompaktheit. Es gibt auf jeden Fall einen Ort, zu dem man
gehen kann und weiß, dass man dort etwas sehen kann. Zu ganz
verlässlichen Öffnungszeiten, das ist mir wichtig. An jeder Arbeit
wird auch eine Person als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung
stehen.
kultur.west:
Das Thema des ersten »Ruhr Ding« ist Territorien…
PETERS:
Das war einfach naheliegend bei 53 Städten und einem ÖPNV, der in
manchem eher trennt als verbindet. Das Ruhrgebiet will
zusammenwachsen und dann gibt es immer wieder Abgrenzungsrangeleien
zwischen den Städten. Manchmal ist das Ruhrgebiet wie Europa im
Kleinen. Es ist also genauso ein regionales wie ein globales Thema.
Wir befinden uns im Brexit-Jahr. Überall erstarken identitäre
Bewegungen, die mit einer territorialen Wurzel argumentieren. Der
Hardware Medienkunst Verein in Dortmund wird sich in einer
Ausstellung damit auseinandersetzen und auch die Arbeit von Ulrike
Naumann, die sich hier im Ruhrgebiet mit der Prepper-Szene
beschäftigt. Also mit Menschen, die sich auf einen imaginierten Tag
X vorbereiten, für den sie Nahrungsmittel und Waffen einlagern.
kultur.west:
Sind territoriale Festschreibungen das Kernproblem des Ruhrgebiets?
PETERS:
Man macht es sich dadurch zumindest komplizierter. Natürlich
verstehe ich, dass es Unterschiede zwischen den Städten gibt und
geben muss. Aber zurück zum ÖPNV als Beispiel: Da bringt es einfach
nichts, die Dinge nicht gemeinsam zu planen und dadurch ein
Vorankommen der Menschen und der Region zu erschweren. Es betrifft
aber teilweise auch die Kulturinstitutionen. Ich finde es toll, dass
es hier so einen Reichtum an Institutionen gibt, aber es bringt
nichts, wenn man nicht das nötige Geld dafür hat. So dass es nicht
möglich ist, eigenständige Profile zu entwickeln. Auch das könnte
viel besser sein, wenn man gemeinsam planen würde.
kultur.west:
Warum sind beim ersten »Ruhr Ding« Dortmund, Bochum, Essen und
Oberhausen dabei?
PETERS:
Das hat sich aus dem Planungsprozess ergeben. Wir haben die Wahl der
Orte erstmal den Künstler*innen freigestellt. Da kristallisierte
sich dann diese Zusammensetzung an Städten für die erste Ausgabe
heraus. Das wird sich in den nächsten Jahren aber ändern. Das
zweite »Ruhr Ding« im kommenden Jahr hat das Thema Klima und wird
dann im Norden in der Emscherregion stattfinden. 2021 sind wir im
Süden und 2022 im Westen.
Vor
einem Jahr hat Britta Peters die Leitung der
Urbane
Küste Ruhr von ihrer Vorgängerin Katja Aßmann
übernommen. Zuvor war die heute 52-jährige Kuratorin nicht nur
unter anderem Leiterin des Kunstvereins Harburg, sondern hat immer
wieder auch Ausstellungen für den öffentlichen Raum entwickelt –
zuletzt bei den Skulptur Projekten Münster 2015. Mit dem »Ruhr
Ding« hat sie nun für Urbane Künste Ruhr ein Ausstellungsformat
auf den Weg gebracht, das künftig immer im Frühjahr stattfinden
soll.