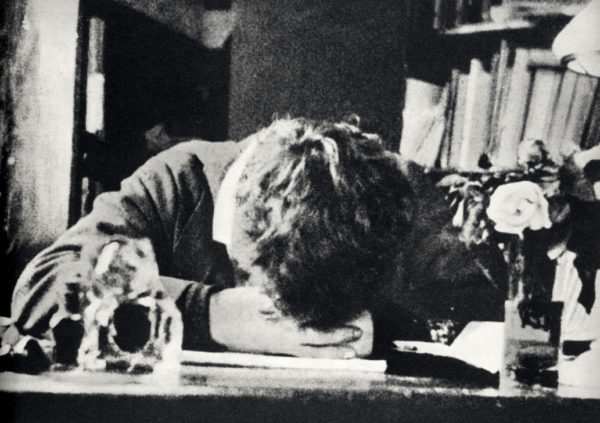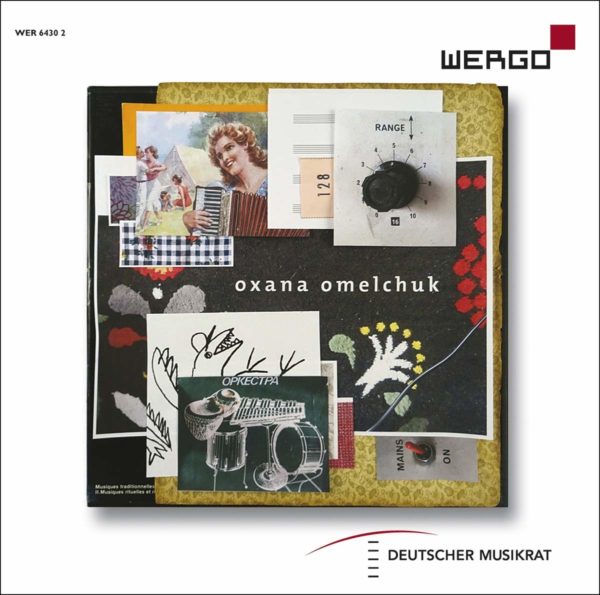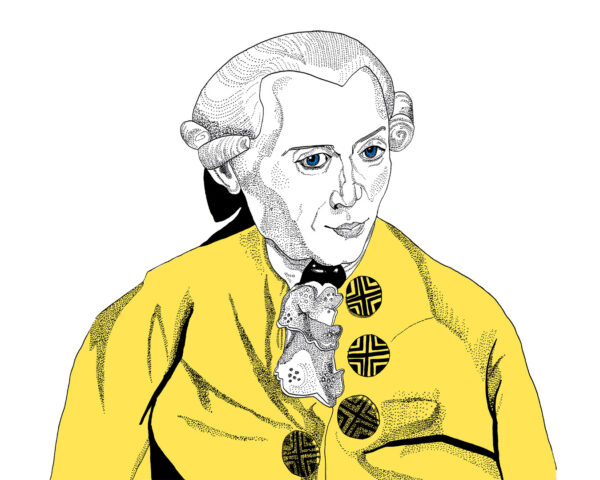Eine Sonderausstellung im LVR-Landesmuseum Bonn untersucht, wie die Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf den drastischen Wandel in der Arbeitswelt reagierte. Zwischen utopischen Hoffnungen und düsteren Visionen entfaltet sich ein Panorama am Puls der Industriegesellschaft.
Alles andere als ein idyllischer Ausblick: In Conrad Felixmüllers Gemälde »Kind vor Hochofen«, entstanden 1927, sehen wir einen kleinen blonden Jungen, der an einem hohen Fenster steht und von der Industriekulisse im Hintergrund buchstäblich an den Rand gedrängt wird. Die Arbeitswelt mit ihren markant-monströsen Fabriken, suggeriert das Bild, durchdringt alles, prägt schon der Kindheit ihren Stempel auf. So war es jedenfalls in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Ruhrgebiet.
Hierhin hatte es Felixmüller (1897-1977), gebürtiger Dresdner, im Zuge eines Studienaufenthalts verschlagen. Das Ziel des Künstlers, der sich in jungen Jahren als Mitglied der KPD politisch engagierte: die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kohlearbeiter und ihrer Familien kennenzulernen und künstlerisch darzustellen. Möglich machte die zeitweise Übersiedelung der Sächsische Staatspreis für Malerei: Nutzten die meisten Preisträger*innen das mit der Auszeichnung verbundene Stipendium für einen Romaufenthalt, so bevorzugte Felixmüller den denkbar größten Kontrast – das rußige Ruhrgebiet. Hier, so seine Motivation für den Ortswechsel, schlägt der Puls der modernen Welt mit ihren technischen Innovationen und gesellschaftlichen Umbrüchen besonders vernehmlich.
Brisanz des Themas
Das unsentimentale Kinderporträt des Malers, dessen Kunst zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit zu verorten ist, zählt nun zu den Höhepunkten einer Themenschau, die das LVR-Landesmuseum in Bonn zeigt. »Schöne neue Arbeitswelt. Traum und Trauma der Moderne« lautet der Titel. In sechs Kapiteln und ebenso vielen interaktiven Medienstationen beleuchtet Kurator Christoph Schmälze, wie sich das Erwerbsleben im Spiegel der Kunst niederschlägt.
In dem Moment, wo Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik verheißungsvoll und bedrohlich zugleich an die Tür der Arbeitswelt pochen (oder sich schon Einlass verschafft haben), scheint das Thema brisanter denn je. Ein Evergreen ist es ohnehin seit dem Sündenfall. Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, verurteilte Gott sie dazu, fortan unter Mühsal den Ackerboden zu bestellen und im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu verdienen. Ein Blick ins »Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache« unterstreicht die überragende Bedeutung der Arbeit. Als Erstglied ist der Begriff dort 455mal gelistet, als Letztglied sogar 468mal. Frei nach Schiller könnte man sagen: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er arbeitet.
So ist es vielleicht kein Zufall, dass derzeit eine Reihe von Ausstellungen ganze Arbeit leisten: Zu nennen sind vor allem »Das Land der tausend Feuer. Industriebilder aus der Sammlung Ludwig Schönefeld« im Ruhr Museum auf Zeche Zollverein, Essen (bis 14.2.2026), sowie die seit kurzem laufende »Feuer«-Schau in der Dortmunder DASA, Deutschlands größter Arbeitswelt-Ausstellung (bis 2.8.2026).
Im Bonner Landesmuseum reicht das zeitliche Spektrum von den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Rund 300 Exponate werden gezeigt, darunter Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Archivalien und Alltagsobjekte. In erster Linie begegnet man Werken bekannter Vertreter*innen von Expressionismus und Neuer Sachlichkeit, beispielsweise Leo Breuer, Otto Dix, Hannah Höch, Lotte B. Prechner oder Albert Renger-Patzsch. Parallel gilt es etliche Künstler*innen zu entdecken, deren Namen weniger geläufig sind – Gerd Arntz, Barthel Gilles, Sella Hasse, Erna Lendvai-Dircksen oder Magnus Zeller zählen dazu.
Landwirtschaft und Industrie im Nebeneinander
Welche Spuren der Beruf in Antlitz und Habitus eines arbeitenden Menschen hinterlässt, ist ebenso Gegenstand der Ausstellung wie das Wachstum der Städte und das fürs Rheinland charakteristische Nebeneinander von Landwirtschaft und Industrie. Außerdem wirft die Ausstellung Schlaglichter auf die strikte Taktung des Arbeitsalltags durch die Fließbandproduktion, den sozialen Aufstieg, der mit Erfolg im Beruf verbunden war (und ist), und die Kritik am Kapitalismus – im frühen 20. Jahrhundert stellten vor allem die »Kölner Progressiven« ihre Kunst in den Dienst der proletarischen Sache. Nicht zuletzt geht es um die Frage, welche Rolle Erwerbsarbeit in Zukunft spielen wird.
Angesichts rasanter Fortschritte der Künstlichen Intelligenz und immer weiter ausgreifender Automatisierung von Produktionsabläufen brennt dieser Aspekt vielen unter den Nägeln. Freilich gehören radikale Umwälzungen der Arbeitswelt schon seit dem Beginn der Industriellen Revolution zu den Kennzeichen der gesellschaftlichen Entwicklung. Das gilt auch und im Besonderen für die Jahre zwischen 1890 und 1940, also dem Beobachtungszeitraum der Bonner Ausstellung. Oktoberrevolution, Erster Weltkrieg, chronisch kriselnde Weimarer Republik, Weltwirtschaftskrise und »Machtergreifung« der Nationalsozialisten – das sind bloß die heftigsten Erschütterungen einer Epoche voller Turbulenzen.
Aber auch voller Dynamik, die im Rheinland wie unter einem Brennglas studiert werden kann. In Köln entstand ab 1929 mit den Ford-Werken ein großer Industriekomplex. Bayer in Leverkusen und Henkel in Düsseldorf standen dem nicht nach. Weshalb der Kurator Christoph Schmälze die Region »als Labor moderner Arbeitsweisen und ihrer künstlerisch-ästhetischen Reflexion« bezeichnet.
»SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT. TRAUM UND TRAUMA DER MODERNE«
LVR-LANDESMUSEUM BONN
13. NOVEMBER BIS 12. APRIL 2026