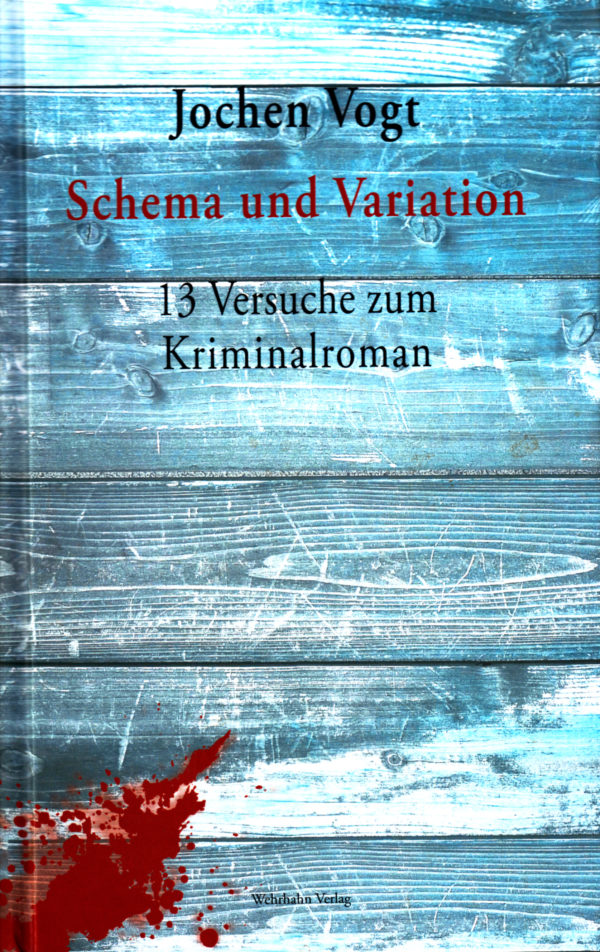Wie im Fernsehen, so auf der Bühne: Ohne Opfer kein Anfang. Aber wer soll das Opfer spielen? Niemand unter den drei Schauspielerinnen und drei Schauspielern möchte so richtig, denn immerhin sind die, die das Oper spielen, ja schnell aus dem Spiel. Die Uraufführung der unter anderem an der Volksbühne Berlin sozialisierten Autorin und Regisseurin Nele Stuhlers heißt »Soko Tatort« und zieht das Genre der sonntagabendlichen Fernsehkrimis durch den Kakao.
Schon die ersten Minuten dieses Gerangels geben vor, wie die nächsten exakt 90 Minuten – denn genau so lange ist im »Tatort« Zeit, auch die komplexesten Fälle zu lösen – aussehen werden: Die Dialoge nehmen Struktur und soziokulturelle Wirkung des Fernsehkrimis auseinander und aufs Korn. Die Kommissare in dieser Sonderkommission Tatort heißen Bär, Wuttke oder Prahl – nach bekannten Schauspielern der Reihe. So sagt eine der Bühnen-Kommissarinnen von sich: »Ich bin der Ermittler-Bär!«
Aber die Dialoge sind nicht nur klamaukig, sondern auch hintergründig: Eine der Kommissarinnen knipst ein Selfie und sagt: »Das stell ich gleich mal in die Chatgruppe.« Zusammen mit einem Schild im Bühnenbild, dass die Oury-Jalloh-Straße ausweist, reicht das, um auf das Problem rechter Gesinnung in der Polizei aufmerksam zu machen, die durch den Inhalt von Chatgruppen öffentlich wurde. Oury Jalloh war ein in Deutschland geduldet lebender Afrikaner, der in einer Gewahrsamszelle in Sachsen-Anhalt tot aufgefunden wurde. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt.
Voll von gelungenen Gags
In Anruf-Situationen bricht die Inszenierung rechtsphilosophische Fragen auf angenehm konsumierbare Länge herunter: Da beschwert sich einer am Telefon, weil ein Mitfahrer in der U-Bahn einen Sitz mit seiner Tasche belegt. »Was würden sie sich wünschen, das wir tun?«, fragt die Polizistin. Der Fahrgast fantasiert daraufhin ein Szenario, in dem der Sitzblockierer in eine Bahn steigt, wo jeder Sitz, den er gern einnehmen würde, immer gleich von einer Tasche blockiert wird.
»Soko Tatort« ist voll von gelungenen Gags, die nicht nur die bekannten Traditionen und die Evolution der Fernsehfilme zum Thema machen (Warum muss zum Beispiel immer irgendein Kommissar irgendwelche Kinder irgendwo hin bringen?), sondern auch die Frage stellen, was uns eigentlich fasziniert an der Form des Krimis. Stillen sie unsere Sehnsucht nach einer gesellschaftlichen Normalität, die am Ende ja meistens hergestellt wird? Brechen sie komplexe Zusammenhänge auf leicht konsumierbare Geschichten herunter? Sind das also eigentlich Märchen, die aber behaupten, aus der Tuchfühlung mit der Realität zu entstehen?
An zwei Stellen verhebt sich dieses großartig schnoddrige Stück mit einem blendend aufgelegten Ensemble (besonders toll als ins Absurde gespreizte Kommissarinnen: Ines Marie Westernströer und Lisa Hrdina) allerdings: Da der Mord des Abends in einer Theatergruppe stattfindet, gibt es auch ein Stück im Stück, das mit einer merkwürdigen Fantasie-Sprache und rudimentären Szenen unser System von Überwachen und Strafen herzuleiten versucht. Und in einem längeren Monolog gegen Ende transportiert Lisa Hrdina Kritik an der ausführenden Staatsgewalt als solcher. Im Prinzip sagt sie, man müsse sich doch nur mehr Zeit nehmen, miteinander zu reden – anstatt immer gleich die Polizei einzuschalten. Da hätte es vielleicht doch noch einmal 90 Minuten gebraucht, um das Thema weiter auszuführen.
Wieder am 20. und 28 . Januar, 2., 6. und 16. Februar