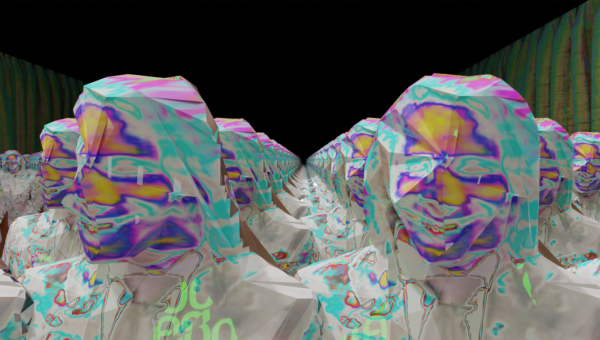TEXT: ANDREAS WILINK
In den unheldischen Filmen des Helmut Käutner sind die exemplarischen Helden-Darsteller Hans Albers als Hannes Kröger in »Große Freiheit Nr. 7« und Curd Jürgens, vor allem als »Des Teufels General« Harras. Zwei Untergeher, doch ebenso zwei gestandene Mannsbilder – der Begriff ist so veraltet wie der Ehrbegriff, den sie in ihren Rollen pflegen. Nicht zu vergessen, es gibt auch noch Heinz Rühmann, in jüngeren Jahren als Schneidergeselle Wenzel, viel später dann als Schuster Voigt, Hauptmann von Köpenick: beide Charaktere Beispiel dafür, dass Kleider Leute machen. Einiges vom Wesen dieser drei so unterschiedlichen deutschen Idole, zumindest ihrer Spielart ist übergegangen auf Ulrich Tukur, den blonden, feschen, treuherzigen, beherzten, draufgängerischen, besonderen Jedermann (den er in Salzburg übrigens ein paar Jahre lang auch gegeben hat).
Albers’ von Sehnsucht und Vergeblichkeit umschattete Aufrichtigkeit, Jürgens’ in Wehmut getränkte Männlichkeit, die ihr Wanken und ihren Sturz zu erahnen glaubt, Rühmanns Verschmitztheit, die nicht immer nur am Possierlichen Genüge fand – es sind die besten Attribute, die sich in Tukur aufgehoben haben. Und die er mit einer gewissermaßen hanseatischen Noblesse, die lieber unterspielt als auftrumpft, verkörpert. Angeblich ist er auch im Besitz eines Kamelhaar- und eines Ledermantels des von ihm bewunderten Albers.
Tukur, der Käutners Filme in ihrem poetischen Realismus und ihrer fast französischen Anmut bewundert, erhält den mit 10.000 Euro ausgestatteten Helmut-Käutner-Preis der Landeshauptstadt. Er ist der 14. Preisträger, in einer imponierenden Reihe u.a. mit Lotte Eisner, Wolfgang Kohlhaase, Enno Patalas, Rudolf Arnheim, Wolfgang Staudte, Bernhard Wicki, Christoph Schlingensief, Dieter Kosslick, Wim Wenders und zuletzt Christian Petzold. In der Mehrzahl Filmwissenschaftler, Filmhistoriker, Filmvermittler, Film-Gesamtkunstwerker, Regisseure und Autoren. Als Schauspieler wurden nur Hildegard Knef und Hannelore Hoger geehrt. Der Preis wurde begründet aus der Idee, nicht vorrangig populäre Künstler auszuzeichnen, sondern den Scheinwerfer auf die Rückseite des Kinos und deren fast unsichtbare Vertreter zu richten. Es sollte kein zweiter Bambi, keine weitere Goldene Kamera, keine Lola sein, die Tukur natürlich alle hat.
Wer, wenn nicht »die Eisnerin« (Werner Herzog) als erste Preisträgerin hatte den Maßstab gesetzt: die deutsche Jüdin aus Berlin, die Kunsthistorikerin, die mit »Die dämonische Leinwand« ein Standardwerk zum deutschen expressionistischen Stummfilm verfasst hat, die ihr Heimatland verlor und nach dem Krieg in Frankreich zur Mitbegründerin der Cinémathèque Française und liebenden Förder-Instanz für die junge Deutsche Film-Generation wurde. Gehört Tukur in diese Reihe? Auch im Vergleich zur Knef, die Ausnahme-Erscheinung als Künstlerin und in ihrer Reibung an Deutschland blieb, und zu Hoger, die durch ihre Arbeit mit Alexander Kluge im Film und mit Peter Zadek im Theater Ikone einer Epoche wurde, weit vor »Bella Block«.
Die Jury argumentiert so: »Seit den achtziger Jahren verkörpert er überzeugend oftmals widersprüchliche Männerfiguren in deutschen und internationalen Filmproduktionen. In seiner Zusammenarbeit mit wichtigen Regisseuren gelingen ihm … Charakterdarstellungen von bleibender Wirkung. Mit großer Präsenz und Vitalität hat Ulrich Tukur das deutsche Kino, Theater und Fernsehen geprägt. Er liebt das schauspielerische Risiko, ganz besonders in historischen Rollen, und setzt sich damit bewusst in Beziehung zum Werk von Helmut Käutner.«
Man kann der Begründung folgen, ohne Tukur in letzter Konsequenz als Käutner-Preisträger zu sehen, und ihn sowieso als Künstler schätzen, sogar bis in das Herz-Kreislaufsystem, das ihn mit einem früheren Schauspieler-Organismus verbindet. Tukur hat ein Faible fürs Früher, als fühle er sich im falschen Jahrhundert beheimatet. Und pflegt eine unangestaubte Form der Nostalgie. Sucht da jemand Sicherheit oder eine Art von Trost in der Vergangenheit? Von »Einstweh«« spricht Botho Strauß.
Selbst ein fast altmodischer Typ, im Aussehen, im Denken, seinen Neigungen: Als Lieblingsbuch nennt er Joseph Roths Abgesang »Radetzkymarsch«; er bevorzugt (nachgeschneiderte) Anzüge und Chansons der zwanziger und dreißiger Jahre, die er mit seiner Band, dem Quartett »Rhythmus Boys«, singt (neuerdings ergänzt durch Jazz- und Swing-Standards). Er schätze bestimmte Dinge, wie »um der Realität zu trotzen« hat er im Gespräch mit dem ZEIT-Magazin gesagt. Und habe erkannt, wie sehr er sich »in den Tiefen verorte, in den Vergangenheiten, die meine Existenz erst möglich gemacht haben«.
Dass ihm Lärm und Tempo einer stumpfer werdenden Gegenwart unangenehm sind, er sich Gegenwelten und Gegenmodelle sucht, ist leicht zu glauben. Auch wenn Tukur etwas Quickes, Fixes, Gewitztes hat: ein unruhiger Geist, beweglich, charmant, energievoll. Ein Nervenschauspieler. Aber doch zu reell für die Beschädigungen, die daraus erwachsen können, Spiel und Wirklichkeit zu verwechseln, wie er im Leben und Sterben der vertrauten Kollegin Susanne Lothar erfahren musste.
Das kann man delegieren – zum Beispiel an die Literatur. Tukurs fantastische, im Stil einer Gothic Novel verfasste Erzählung »Die Spieluhr« funktioniert wie ein Spiegelkabinett, in dem sich die eine wahre Ansicht bricht, der Stoff sich schichtet zu mehreren Erzählebenen und durch drei Jahrhunderte wandelt. Die Figuren werden von Gobelins und Gemälden aufgesogen und kommen so der Wirklichkeit abhanden, weiterlebend in der Kunst und in einem anderen Zustand: Leben hinter den Bildern.
Geboren 1957 im hessischen Viernheim als Ulrich Gerhard Scheurlen und ausgebildet an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, nachdem er sich in Tübingen für Geisteswissenschaften eingeschrieben hatte, kam Tukur über Heidelberg und München in Kontakt zu Peter Zadek und während der 1980er Jahre zu ihm nach Berlin und ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg. In Joshua Sobols »Ghetto« spielte er – neben Michael Degen und Esther Ofarim – den SS-Offizier Kittel: smart und brutal, nicht engstirnig, verführerisch. Hätte es schon Quentin
Tarantino gegeben, hätte der in dieser Totentanz-Revue und der kultivierten »blonden Bestie« seinen Christoph Waltz vorgefunden. In Zadeks legendärer »Lulu« mit Susanne Lothar war er auch dabei.
Tukur hat Geschichte studiert. Nicht nur deshalb ist er prädestiniert als Darsteller historischer Gestalten: Herbert Wehner, Erwin Rommel, Helmut Schmidt, Andraes Baader, demnächst Bernhard Grzimek oder der preußische Kunstsammler Wilhelm Uhde (in dem französischen Film »Séraphine«) sind ihm gewissermaßen auf den Leib geschrieben. Figuren, die den Zugang zu sich erschwert haben. Den Widerspruch in sich tragende Figuren, die ihn aushalten, daran wachsen, daran zu Grunde gehen – implodierend oder explosiv. Er liebe Rollen, in denen »Menschen in geschichtlicher Verantwortung stehen, sich verhalten müssen und scheitern«. Da schwingt Schwermut mit, die den Heranwachsenden offenbar veranlasst hatte, eine Wand in seinem Zimmer mit Todesanzeigen zu
dekorieren. Und wer wie er (mit seiner zweiten Frau, der Fotografin Katharina John) in Venedig auf der Giudecca lebt, hat den Verfall ohnehin Tag um Tag vor Augen.
Tukur, 1986 zum Schauspieler des Jahres gekürt, besonders für die Shakespeare-Rollen Marc Anton (»Julius Caesar«) und Orlando (»Wie es euch gefällt«), später gemeinsam mit Ulrich Waller Intendant der Hamburger Kammerspiele, hat mit dem Theater abgeschlossen. Eine Ära ging zu Ende, als er mit dem Akkordeon in Lucca Abschied nahm am Grab von Peter Zadek, dem zärtlichen Menschenfresser, der sich auch an Tukur gelabt hatte, wenngleich nicht so sehr wie an den Herzen vieler Frauen. Er dreht, häufig fürs Fernsehen. Sein »Tatort«-Kommissar Felix Murot unterhält mehr als eine Beziehung zum Tode.
Aus zwei Dutzend Kinofilmen Tukurs sollen vier Beispiele genügen, wobei seltsamerweise die Komödie deutlich in der Minderheit bleibt: der Baron in Michael Hanekes »Das weiße Band« – jähzornig, hochmütig, adelsstolz und autoritär. John Rabe, der gute Deutsche, Kaufmann im Dienst von Siemens, der in Nanking während des Krieges die chinesische Bevölkerung vor dem Zugriff der Japaner, Hitlers Verbündeten, schützt. Der lauernd schlaue Oberstleutnant im Stasi-Melodram »Das Leben der Anderen«, der nicht den Fehler macht, zu empfinden. Der alkoholkranke, vom neokapitalistischen Raubbau an der menschlichen Natur beschädigte Headhunter in »Houston« von Bastian Günther. Jeweils Zerrissene, Einsame, heimatlos auf der einen oder anderen Seite der historischen Wahrheit und verletzt von den Verwerfungen ihrer Zeit.