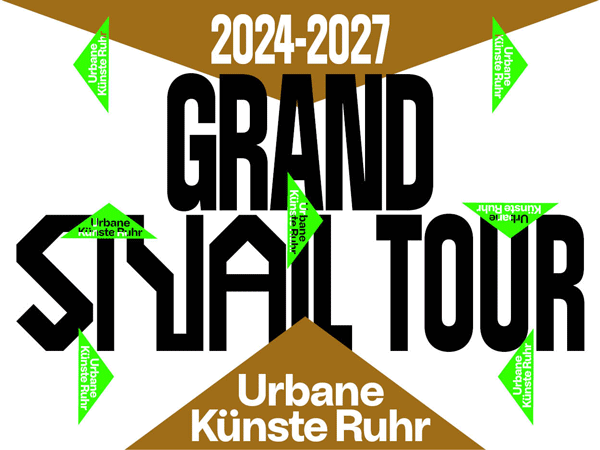…sind insbesondere soziale Fragen rund um Konsumverzicht. In unserer Gesellschaft wird man ab Geburt zum Konsumenten erzogen, Konsum wird mit Wachstum gleichgesetzt und wenn die »Konsumentenlaune« fällt, gilt das als schlechtes Zeichen. Konsumverzicht im Gegensatz dazu ist negativ besetzt. Oft entsteht das Gefühl, man wolle etwas wegnehmen, madig machen. Aber ich erlebte anhand der Resonanz auf mein früheres Buch »Das Wenige und das Wesentliche«, dass in einer Gesellschaft des Zuviel zahlreiche Menschen einen Ausweg suchen. Doch Askese ist auch ein Privileg. Es heißt nämlich nicht, zwangsweise zu verzichten, sondern sich dazu zu entscheiden. Das setzt eine Wahl voraus. Mit Askese ist also eine soziale Frage verklammert, das wird oft ausgeblendet.
In dem Kontext habe ich mich an eine Studienkollegin erinnert, die mich enorm beeindruckt hatte: Als Lehrerkind gehöre ich zu den zwangsläufig bildungsnahen Haushalten. Meine Kommilitonin Fiona kam aus einer ganz anderen Ecke. Man sagt gern Arbeiterkind, aber ihre Eltern waren eher arbeitslos als arbeitend und lebten in einem der prekärsten Viertel Glasgows. Von Fiona stammt der Satz »Ich möchte lieber nichts« und sie beeindruckte mich durch ihr Selbstbewusstsein und ihre Entschlossenheit, ihre Lebensweise zu vertreten, von der ich damals nur die Hälfte verstand. Sie wurde für mich eine sehr wichtige, authentische Stimme.
Wie kann man in diesen Verhältnissen das Thema Askese angehen? Zu dieser Frage begann ich 35 Jahre später ein Gespräch mit Fiona und darin kam eine zweite soziale Frage auf, die mir zuvor nicht bewusst war: die der Einsamkeit. Es ist nicht nur ein privates Thema, das Bild des Asketen ist auch das des Einsamen, des Rückzugs von der Welt auf sich. Dagegen plädiere ich für eine lebensbejahende Form von Askese. In der Folge wurde das Buch zu schreiben für mich drängend. Es ist keine soziologische Studie, die ich da verfasst habe, sondern gelebte, persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich habe schließlich selbst mehr durch konkrete Lebensgeschichten gelernt, als durch abstraktere Schriften.
Da ist auch ein Dissens zwischen Fiona und mir: Ich bleibe der unverbesserliche Individualist, bei mir selbst anzufangen. Wer Kinder hat, merkt, man kann viel erzählen, aber entscheidend ist, was man tut. In meinem Leben gibt es Entscheidungen, die zeigen, dass ich lernfähig bin und an mir arbeite. Das wäre für mich Fortschritt. Fiona würde Fortschritt sicher viel politischer sehen und mir jetzt sagen, das sei eine romantisierte Weltverbesserungsvorstellung angesichts bestehender Machtverhältnisse. Ich würde entgegnen, was soll ich tun, eine Partei gründen, die Luft aus SUV-Reifen lassen, was hat wirklich gesellschaftsverändernde Kraft? Ich bin skeptisch gegenüber ganz großen Entwürfen. Die Krux ist ja, dass man das Gefühl hat, dass Kapitalismus als Übersystem die Welt beherrscht. Der Spruch, das Ende der Welt sei einfacher vorstellbar als das Ende des Kapitalismus, drückt das aus. Ich empfinde da vor allem Ohnmacht, daher bin ich eher der Veränderer kleiner Schritte.
»Ich glaube, dass Konsum zu einem großen Teil Kompensation ist.«
John von Düffel
Doch wie Fiona sagt, kein Konsumartikel ist dazu da, dauerhafte Befriedigung zu stiften, sondern den Wunsch nach immer mehr zu triggern: Unglück, nicht Glück, konsumiert. Das Gefühl, dass man nicht genug hat oder ist, ist die Wurzel. Wer wie Fiona auf eine besondere Weise zu sich steht, auch zu den Fehlern und Mängeln, ist auf eine Art sehr unerschütterlich. Kurzum, es gibt einem Kraft und Freiheit, sich aus dem Vergleich herauszunehmen: Das habe ich nicht, na und?
Jeder Service, jedes Produkt schafft im Gegensatz zur Werbeideologie eine Abhängigkeit. Wenn ich nun auf Konsum verzichte, verzichte ich darauf, mich abhängig zu machen. Der Freiheitsgewinn ist enorm. Ein banales Alltagsbeispiel: Wer S-Bahn fährt, sieht viele Thermobecher, fast als könnte man ohne nicht mehr pendeln. Natürlich ist es nett, mal einen Schluck daraus zu trinken, aber in jedem Produkt steckt auch eine Belastung: Der Thermobecher etwa muss ständig gereinigt werden. Auch als Dozent merke ich, dass Studierende oft völlig erschöpft zum Seminar kommen, weil sie sich davor online den Kopf vollgestopft haben. Manchmal scrolle ich mich auch dumm, mir passiert das schon auch. Man opfert einiges an Lebenszeit, doch die Einsamkeit bleibt. Gerade wenn man das Gerät wieder abschaltet, ist sie enorm.
An Weihnachten versuche ich daher das Gemeinschaftsstiftende zu sehen: Ein Ritual oder familiäre Gewohnheiten können einen mit Menschen zusammenbringen, die einem im Alltag mal entgleiten. Es ist ein Konsumfest, materieller Wahnsinn, das wissen ja alle. Alles, was Verbindung schafft, Nähe ermöglicht, ist aber schon einmal auf der richtigen Seite. Verbindungen ermöglichen auch neue Blickwinkel: Durch das Gespräch mit Fiona und ihren ganz anderen Hintergrund sah meine Perspektive sich infrage gestellt. Ich habe daraufhin entschieden, meine blinden Flecken, so peinlich sie sind, im Buch offen zu legen. Es ist ein Vorteil des Älterwerdens, dass einem manches nicht mehr so peinlich ist, wie es das früher gewesen wäre. Bei Lesungen habe ich aber gemerkt, dass Fionas Humor sich weniger entfaltet, als ich das mit ihr selbst erlebt habe. Was ich dem Buch inzwischen hinzufügen würde, gerade bei so einem moralischen Thema, wäre also den Humor nicht zu verlieren. Humor bedeutet oft auch einen winzigen Abstand von sich selbst, mit Dingen empathisch umzugehen und spielerisch. Das macht im Übrigen auch Weihnachten leichter.
Aufgezeichnet von Melanie Schippling
Welche Auswirkungen hat der Konsum – auf unser Privatleben, in unserem Beruf, auf die Umwelt? Darüber denkt John von Düffel in seinem neuen Buch nach. In »Ich möchte lieber nichts« begibt er sich mit einer ehemaligen Studienkollegin auf die Suche nach Genügsamkeit.
John von Düffel: Ich möchte lieber nichts – Eine Geschichte von Konsumverzicht,
DuMont, 208 Seiten, 24 Euro
Name: John von Düffel
Alter: 59
Beruf: Autor, Dozent, Theaterintendant
Wohnort: Potsdam und Bamberg