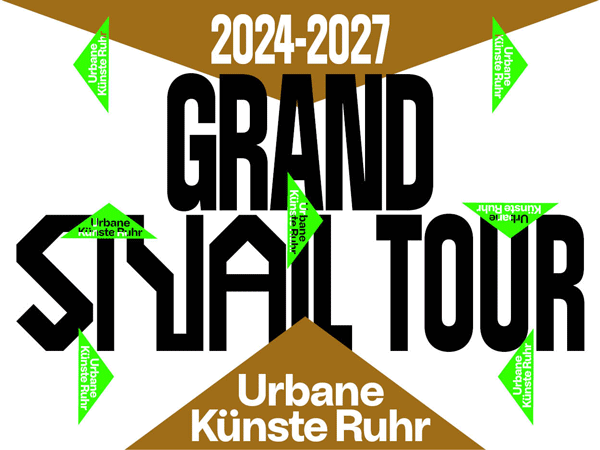Von 1986 bis 1995 war Frank-Patrick Steckel Intendant am Schauspielhaus Bochum. Diese Jahre waren für seine Tochter Jette Steckel eine prägende Phase in ihrer Kindheit und Jugend. Nun arbeitet sie erstmals selbst als Regisseurin am Schauspielhaus und inszeniert dort eine Bearbeitung von Ágota Kristófs »Das große Heft«. Ein Gespräch über berührende Erinnerungen und den Rat, ihren Vater in einen Kühlschrank zu stecken.
kultur.west: »Das große Heft«, Ágota Kristófs Roman über Zwillinge, die während eines Kriegs heranwachsen, ist häufiger für die Bühne adaptiert worden. Worin liegt für Sie sein Reiz?
JETTE STECKEL: Der Reiz liegt ja immer in dem Resonanzraum, auf den ein Text in einer Zeit trifft. Gegenwärtig sind wir stark mit der Realität des Krieges konfrontiert. Das ist für mich ein Grund für die Auseinandersetzung mit dem Text. Bei uns spielt ein Ensemble von fünf Schauspieler*innen die Zwillinge und alle Figuren, die Ihnen begegnet sind. Was im »Großen Heft« das möglichst wahrheitsgetreue notieren der Ereignisse ist, ist bei uns das Re-Enactment von Erlebtem auf der Bühne. Dass nicht zwei Schauspieler*innen die Zwillinge spielen, sondern alle mal, stärkt das Verhältnis der Spielenden zu dem, was sie da erzählen. Erwachsene Schauspieler*innen nähern sich aus ihrer gegenwärtigen Situation einem Text, der sich mit der Frage beschäftigt, was wir eigentlich für Menschen heranziehen, wenn wir Kinder dem Krieg aussetzen. Damit befragen sie eine Realität, die sie selbst außerhalb des Theaters kreieren. Es geht um eine Verantwortung gegenüber der Gegenwart, die wir schaffen.
kultur.west: Ágota Kristófs Roman konfrontiert uns automatisch mit einer von Kriegen und Verteidigungsdebatten geprägten Wirklichkeit.
STECKEL: Die Zwillinge, von denen nicht klar ist, ob es tatsächlich zwei sind, oder doch nur ein Junge und sein alter ego, machen im Roman und bei uns auf der Bühne einen Desillusionierungs- und Transformationsprozess durch. Sie versuchen, sich der Gegenwart des Krieges gegenüber abzuhärten, sich zurechtzufinden und selber handlungsfähig zu werden. Sie müssen erkennen im Krieg, geht es nicht um Nächstenliebe und auch nicht um die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Wie denn auch? Es geht eher darum, dafür zu sorgen, dass du selbst überlebst, im direkten oder indirekten Sinn. Man kann das auf den Kapitalismus übertragen, aber natürlich auch ganz direkt auf die Konsequenzen von Aufrüstung und Krieg. Persönlich kann ich für mich sagen, ich weiß, dass es viele Argumente dafür gibt, dass wir bereit sein müssen, uns oder zum Beispiel unsere Demokratie zu verteidigen. Die Frage ist nur mit welchen Mitteln. In dem Moment, wo ich damit konfrontiert bin, meinen Sohn wieder zur Musterung schicken zu müssen, habe ich ein Problem. Für mich ist es keine Option, ihn vor die Mündung einer Waffe treten zu lassen.
kultur.west: Ist vielleicht genau das eine Aufgabe von Theater, uns mit diesen Widersprüchen in uns zu konfrontieren?
STECKEL: Zumindest sollten sich das Theater und die Kunst nicht selbst beschneiden, etwa durch Diskussionen darüber, dass bestimmte Dinge nicht mehr dargestellt werden sollen. In der Arbeit an dieser Inszenierung ist mir irgendwann klar geworden, dass alles, was ich über Krieg weiß und was ich mit Krieg verbinde, auf Filme, Dokumentationen, Literatur und Fotos zurückzuführen ist. Bestimmte Dinge in ihrer Grausamkeit zu begreifen, funktioniert nicht nur darüber, dass ich sie am eigenen Körper erlebe, sondern eben zum Glück auch durch Literatur oder Theater, also über Kunst, über Reproduktion.
kultur.west: Ja, das Theater kann in dieser Hinsicht sehr wirkmächtig sein. Meine Vorstellungen von Krieg haben neben Filmen auch Inszenierungen von Ihrem Vater Frank-Patrick Steckel am Schauspielhaus Bochum geprägt, Arbeiten wie »Winterschlacht« und »Germania. Tod in Berlin«.
STECKEL: Das ist doch wirklich eine schöne Erkenntnis über Theater und zugleich seine Ursprungsfunktion, wie ich sie jedenfalls verstehe. Das Theater war ja mal der Ort, politische Möglichkeiten und Entwicklungen zu antizipieren und dadurch wählen zu können. Wenn wir von der griechischen Tragödie ausgehen, ist es ein diskursives politisches Organ. Das Theater stellt zum Beispiel Ereignisse dar, die noch nicht geschehen sind, und eröffnet mir dadurch Perspektiven auf politische und gesellschaftliche Prozesse. Ich durchlebe im Theater ja wirklich Gefühle nur dadurch, dass mir da etwas vorgespielt wird.

kultur.west: Was bedeutet es für Sie, ans Schauspielhaus, die Wirkungsstätte Ihres Vaters, und in die Stadt zurückzukommen, in der Sie als Kind und Jugendliche aufgewachsen sind?
STECKEL: Hier zu arbeiten ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Ich habe immer gewusst, wenn jemand anruft und fragt, ob ich hier was machen will, dann sage ich sofort zu. Und das habe ich auch gemacht. Das Schauspielhaus war für mich als Kind ein großartiges Zuhause. Ich war eigentlich immer hier, jeden Tag. Meine Eltern waren beide ständig hier, also wäre ich sonst einfach allein zu Hause gewesen. Deswegen war mein Anlaufpunkt nach der Schule dieses Haus. Insofern habe ich sehr viel hier gelernt, schließlich habe ich an die zehn Jahre hier verbracht. Damals habe ich all die Inszenierungen gesehen.
kultur.west: Diese Erinnerungen begleiten Sie hier auf Schritt und Tritt…
STECKEL: Ich habe sozusagen Erinnerungen an alles einen Meter tiefer, als ich es heute wahrnehme. Das hat was mit Geräuschen und der Haptik von Klinken und so zu tun. Oft habe ich oben auf der Rasterdecke gelegen, mit dem Bauch nach unten. Das wusste niemand, aber ich konnte so auf die Köpfe der Schauspieler schauen, während sie spielten. Aber ich merke jetzt schon auch, dass meine Schutzschicht hier relativ dünn ist. Es ist so, wie in eine Konservendose voller Kindheit zu springen. Also ich bin mir in meiner Rolle an anderen Orten, wo ich einfach neu auftreten kann, ehrlich gesagt, sicherer als hier, wo ich mich immer ein bisschen emotional aufgeweicht fühle. Wenn ich auf der Probebühne bin, habe ich sehr lebendige Erinnerungen daran, wie mein Vater genau da saß, wo ich jetzt sitze. Es ist gut als Erfahrung, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin genau da angekommen, wo ich immer hinwollte. Aber definitiv wunderbar, an dem Ort, in diesem schönen Haus zu sein, an dem ich meine Liebe zum Theater entdecken durfte.
kultur.west: Liegt das Werk ihres Vaters wie ein Schatten über ihren eigenen Arbeiten?
STECKEL: Es gab einen Moment in meinem Studium an der Hamburger Theaterakademie, da wollte ich aufhören, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eine Art Marionette und werde von meinen Erinnerungen und von meiner Familie gesteuert. Also habe ich beschlossen, das Studium abzubrechen. Aber es gab zu dem Zeitpunkt noch ein letztes Projekt, das ich trotz allem noch machen musste. Zu der Zeit war interessanterweise Nicolas Stemann [Anmerkung der Redaktion: der designierte Intendant des Bochumer Schauspielhauses] unser Dozent. Er hat mich gefragt, warum ich das machen will, also abbrechen, und ich habe ihm erzählt, wie ich mich damals gefühlt habe. Er hat daraufhin gesagt: »Sperr deinen Vater doch in den Kühlschrank.« Dazu muss man wissen, dass ein Kühlschrank bei diesem Projekt das einzige Bühnenbild war. Genau das habe ich dann gemacht. Immer wenn die Kühlschranktür aufging, hörte man ihn im Kühlschrank sprechen. Seitdem ist das Thema für mich irgendwie am richtigen Platz gelandet. Auch nach einem Semester in Moskau und Georgien, habe ich dann schließlich doch weitergemacht.
kultur.west: Sie waren als Nachfolgerin von Johan Simons im Gespräch…
STECKEL: Ich habe zwei Kinder, die im Alter von 13 und 15 sind. Im Moment habe ich das Gefühl, ich sollte sie noch in ihrem Pott lassen. Zugleich beschäftigt mich die Idee, ein Theater zu leiten, schon. Allein aufgrund der Tatsache, dass es mir die Möglichkeit geben würde, die Menschen zusammen zu holen, mit denen ich eine gemeinsame künstlerisch Sprache spreche. Durch die Intendanz-Wechsel am Thalia Theater in Hamburg und am Deutschen Theater Berlin, zwei Häuser, an denen ich über längere Zeit kontinuierlich mit Schauspielensembles gearbeitet habe, habe ich schon etwas verloren.
kultur.west: Eine eigene Intendanz wäre eine Chance eine solche Theaterfamilie wieder zusammenzuführen.
STECKEL: Das ist auf jeden Fall etwas, das für eine Intendanz spricht. Im Gegensatz dazu sind die finanziellen Lagen an manchen Häusern und in manchen Städten eher etwas, womit man sich nicht unbedingt auseinandersetzen möchte. Außerdem muss ich zugeben, dass ich meinen Job als Regisseurin liebe. Zu inszenieren, ist viel Arbeit, und eine Intendanz ist ja zusätzliche Arbeit; wobei ich sehr für regieführende Intendanten bin. Meiner Erfahrung nach spürt man es auch, wenn es an einem Haus eine regieführende Intendanz gibt, am Soul.
»DAS GROßE HEFT«
1. NOVEMBER (PREMIERE), 2. & 29. NOVEMBER
SCHAUSPIELHAUS
Zur Person
Jette Steckel, die 1981 in West-Berlin geboren wurde, ist die Tochter des langjährigen Bochumer Intendanten Frank-Patrick Steckel und der Bühnenbildnerin Susanne Raschig und in Bochum aufgewachsen. Studiert hat sie an der Hamburger Theaterakademie Schauspielregie. Seither arbeitet sie an Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine besonders enge Bindung hatte sie zum Thalia Theater Hamburg, an dem sie über mehrere Jahre hinweg Hausregisseurin war, und zum Deutschen Theater Berlin. Zwei ihrer Inszenierungen am Thalia Theater, »Die Tragödie von Romeo und Julia« und »Das mangelnde Licht« nach Nino Haratischwili, wurden mit dem Deutschen Theaterpreis »Der Faust« ausgezeichnet. Mit ihrer Inszenierung von Anton Tschechows »Die Vaterlosen« wurde sie zum Berliner Theatertreffen 2024 eingeladen.