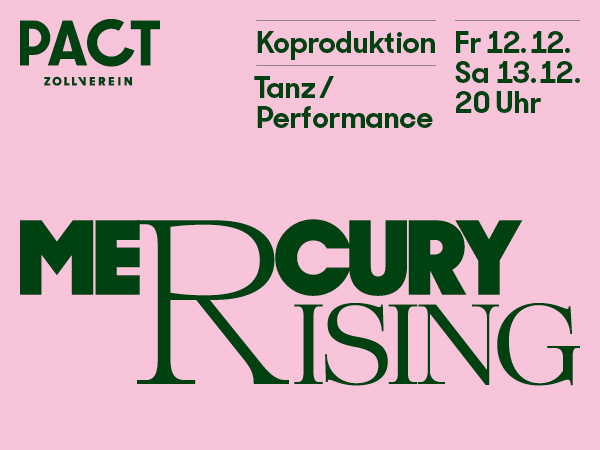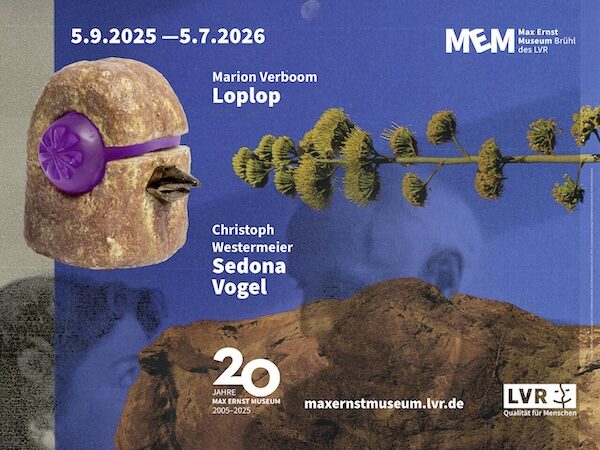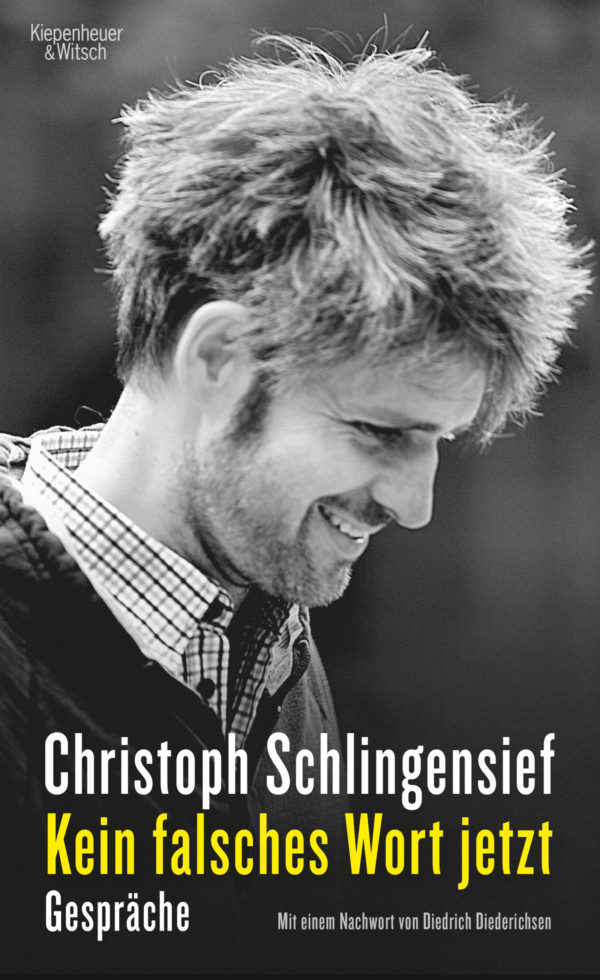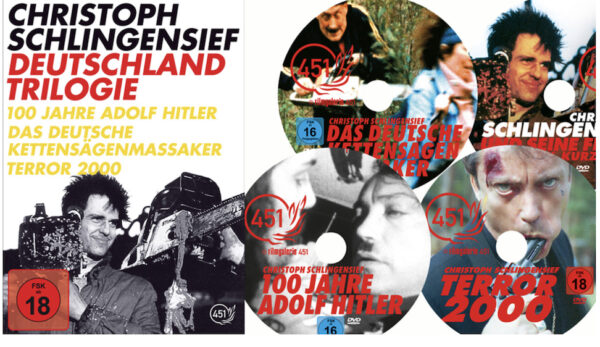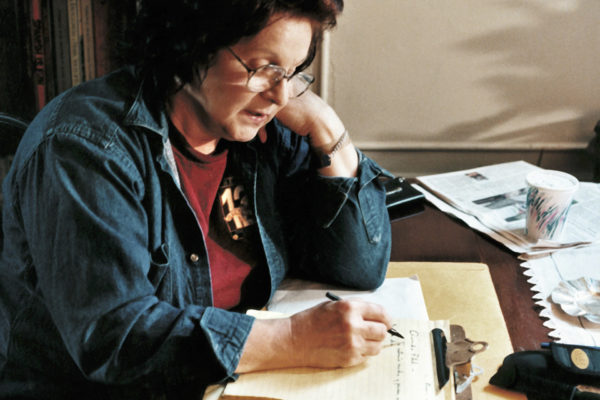Das Literaturhaus und Theater Oberhausen haben eine wunderbare Audiotour geschaffen, die auf 3,8 Kilometern durch die Innenstadt Puzzlestücke liefert, aus denen sich seine künstlerische Biographie zusammensetzt.
Vor dem Haus an der Stöckmannstraße 92 in Oberhausen zu stehen ist ein bisschen, wie durch diese wahnsinnig eintönige Reihenhaussiedlung in Liverpool zu laufen, in der Paul McCartney aufgewachsen ist. Man denkt: Hier soll alles angefangen haben? Wie sollen in diesem Umfeld kreative Funken ein Feuer entfachen? Aber so ist es geschehen: In der Stöckmannstraße 92 lebte bis zu seinem 20. Lebensjahr der große Künstler Christoph Schlingensief und schräg gegenüber dieses Wohnhauses beginnt jetzt eine tolle Audiotour, die erzählt, wie er von Oberhausen aus die Film-, Theater- und Kunstwelt durchrüttelte.
»In diesem Haus wohnte von 1960 bis 2010 der Film- und Opernregisseur Prof. Christoph Schlingensief«, informiert eine Plakette, die zwar golden ist, aber trotzdem so schmucklos wie der gesamte Eingangsbereich des Hauses. Bis zu seinem viel zu frühen Tod hat der Künstler, den es irgendwann nach München und Berlin zog, diesem Ort also die Treue gehalten. Hier hat er oft seine Eltern besucht, deren einziges Kind er war und die ihm sehr wichtig waren. Die Audiotour macht die triste Information der Plakette schnell vergessen, füllt die Häuserfassade und den Altmarkt, an dem sie steht, mit Bildern und Geschichten.

Sie ist denkbar einfach und komplett kostenlos begehbar: Mit dem eigenen Smartphone und Kopfhörern scannt man an der ersten Station am Restaurant Gdanska schräg gegenüber des Elternhauses einen QR-Code – und schon beginnt die Erzählung. Am Anfang jeder der acht Episoden geben die Sprecher*innen eine Wegbeschreibung zur nächsten Station. Verteilt sind sie über einen knapp vier Kilometer langen Rundweg durch die Oberhausener Innenstadt, die aber auch auf einem Flyer verzeichnet oder auf der Webseite mit den Audiospuren verschriftlicht ist.
Wie der Vater fing der Sohn im Elternhaus irgendwann an, mit der Super-8-Kamera zu filmen. Er richtete sich im Keller ein, wo er Kulturabende veranstaltete oder sich mit seiner ersten Freundin traf. Als der Vater die beiden erwischte, wie sie sich unter einem Tisch versteckt näher kamen, lief der junge Christoph Schlingensief einfach hinaus auf den Altmarkt und tat als ob der Vater ein gänzlich Fremder sei: »Lassen Sie uns in Ruhe, sie Drecksschwein!«
Anekdoten wie diese hat der Künstler selbst erzählt. Rainer Piecha vom Literaturhaus Oberhausen, der für die Audiotour mit Mitgliedern des Theaters Oberhausen zusammenarbeitete, hat sich dafür an autobiographischen Büchern bedient: Dem schonungslosen, aber auch wunderschönen Krebstagebuch »So schön wie hier kann‘s im Himmel gar nicht sein«, das noch zu Lebzeiten 2009 erschienen ist, und den posthumen Zusammenstellungen »Ich weiß, ich war‘s« (2012) und »Kein falsches Wort jetzt« (2020).
Franziska Rosa Roth und Klaus Zwick vom Theater lesen diese Selbstzeugnisse und bald merkt man, dass man bei ihnen ein wenig aufpassen muss, denn Christoph Schlingensief ist kein ganz zuverlässiger Erzähler. Vielmehr folgt er seinem eigenen Kunstanspruch, in dem es auch um Improvisation und Transformation geht, darum, spontane Einfälle zu unbedingten Behauptungen zu erklären – je nachdem, wie es gerade ins Konzept passt. Da erzählt er in der ersten Station zum Elternhaus noch, wie er Weihnachten immer Zuhause verbrachte, wo es sehr traditionell zuging. Die Mutter, eine sehr gute Köchin, habe immer befürchtet, das Essen sei versalzen. Worauf der Sohn stets geantwortet habe: »Nein, es ist sehr gut.«
Aha-Moment am Kino Lichtburg
Bei einer späteren Station an seiner ehemaligen Schule, dem Heinrich-Heine-Gymnasium, geht es um seine frühe Künstlerwerdung, darum, wie er in den Jugendclubs der Oberhausener Kurzfilmtage agierte, die in den 1970er Jahren radikal linkspolitisch aufgeladen waren. Schlingensief fand es nicht gut, die Dame aus dem Kassenhäuschen des Kinos Lichtburg zu zerren und sie für eine Dokumentation vor der Kamera zur Rede zur stellen, warum sie Geld für »imperialistische Scheiße« aus den USA kassiere. »Ich wollte mit dem politischen Wahn der 70er Jahre nichts zu tun haben. Ich wollte zwanghaft Harmonie zerstören«, zitieren die Sprecher den Künstler, der »von den Eltern erzogen wurde, die Wahrheit zu sagen«. Auf die Frage der Mutter, ob das Essen schmecke, habe er nie eindeutig antworten können, erzählt er an dieser Stelle: »Kann sein, kann aber auch nicht sein.«
Jede Station, deren Hörtexte zwischen etwa 7 und 15 Minuten lang sind, gibt ein neues Puzzlestück an die Hand, um den künstlerischen Kosmos Schlingensiefs zu verstehen. Am Kino Lichtburg erfahren die Spazierenden von einem besonderen Aha-Moment: Der Vater hat damals Heimvideos mit einer Doppel-8-Kamera gefilmt. Die Filmspule war also in beide Richtungen bespielbar – wodurch auch Fehler wie Doppelbelichtungen passierten. Als der Junge einen Urlaubsfilm des Vaters sah, in dem er mit seiner Mutter am Strand liegt und plötzlich Menschen und Autos über ihre Bäuche laufen oder fahren, da stürzt ihn das in einen Strudel aus philosophischen Gedanken und Fragen.
»Vielleicht ist unser Leben doppelt oder dreifach oder vierfach belichtet. Vielleicht sind wir alle nicht so scharf umrissen und stabil gebaut. Das Leben wird unscharf. Man wird belichtet. Vielleicht wird man nicht der, der man sein wollte.«
Christoph Schlingensief
Er, der offenbar von den Eltern anders gewünscht, ein Einzelkind geblieben ist, habe Vater und Mutter »sechs Kinder darstellen« müssen. Als Assistent des Filmregisseurs Werner Nekes wird Schlingensief früh von einem »Virus gegen den Mainstream« infiziert, lernt von ihm das Godard-Credo, dass Anfang, Mitte und Schluss in einer Filmerzählung nicht unbedingt in dieser Reihenfolge stattfinden müssen. Das beherzigt auch die Audiotour, die je nach Schauplatz in seiner Lebens- und Kunst-Biografie springt. Da hat man in der längsten Episode vor dem Theater Oberhausen längst erfahren, wie er an Bühnenhäusern landete, zu denen er immer ein zwiespältiges Verhältnis hatte, und sogar von Wolfgang und Katharina Wagner nach Bayreuth eingeladen wurde, einen »Parsifal« zu inszenieren – aber an der Aula des Gymnasiums geht es wieder um frühe Filmversuche.
Schon immer, seit er 12 oder 13 Jahre alt war, wollte Schlingensief Filmregisseur werden und zu den spannendsten Episoden des Spaziergangs zählt die an der Tourismus-Information gegenüber des Hauptbahnhofs. Darin erzählen die Sprecher mit den Worten des Künstlers, wie er zweimal versuchte, an der Münchener Filmhochschule angenommen zu werden. Beim zweiten Mal bittet er seinen Apotheker-Vater, den Vater von Wim Wenders anzurufen, der ebenfalls Apotheker war. Der Vater tut es, obwohl er sich nichts lieber gewünscht hätte, als dass sein Christoph Pharmazie studiert, und kurze Zeit später darf der Sohn den damals schon berühmten Wim Wenders in Venedig am Lido treffen. Der Regisseur legt tatsächlich ein gutes Wort für ihn ein – und er wird trotzdem wieder nicht genommen.
Mit diesen Geschichten auf den Ohren läuft man durch Oberhausen wie durch eine Filmkulisse – weil die Welt ja ihres Originaltons beraubt ist. Die kognitive Dissonanz wird dadurch umso deutlicher: Zwischen einem künstlerischen Leben in den großen Metropolen, das visionäre und spektakuläre Aktionen wie die politische Partei Chance 2000, das Operndorf in Burkina Faso oder radikale Biographie-Performances wie »Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir« hervorgebracht hat, die in ihrer Aktualität bis heute nachwirken. Und einer kaputten Stadt mit viel Leerstand, bröckelnder Infrastruktur und offensichtlichem sozialen Elend. Oh, wie sehr würde man diesen Christoph Schlingensief heute noch brauchen, der in beiden Welten Zuhause war und stets die Menschen sichtbar machte, die kaum oder gar nicht gesehen werden.