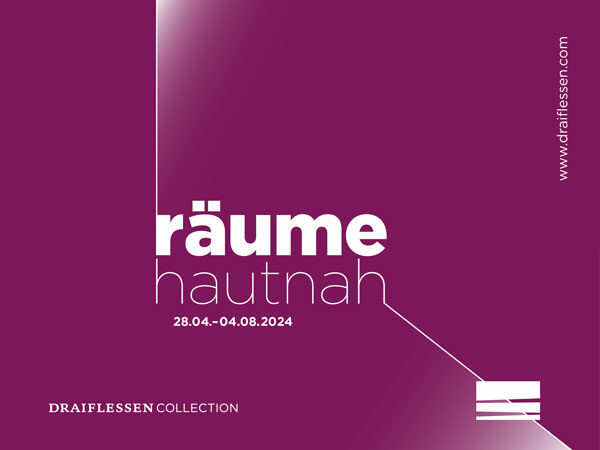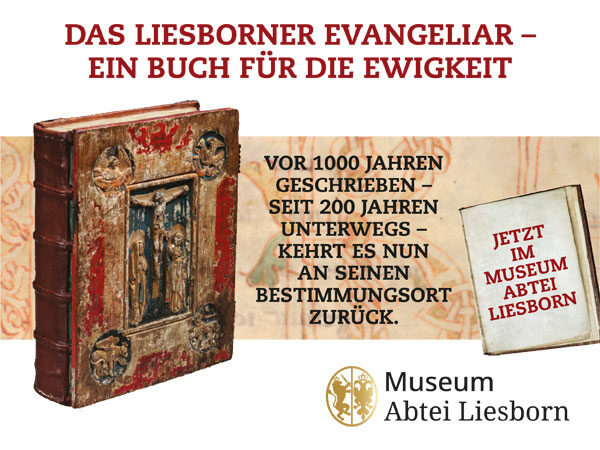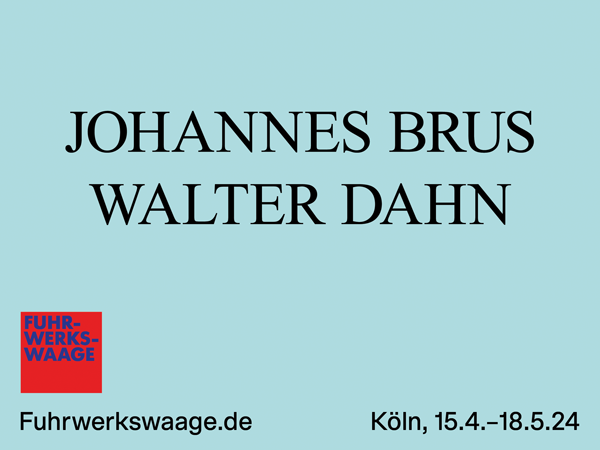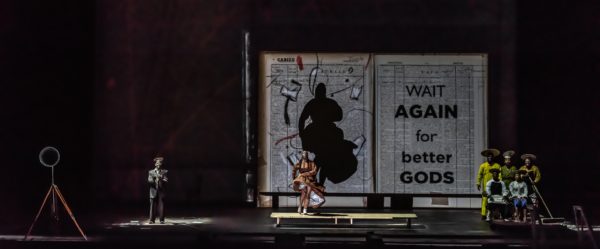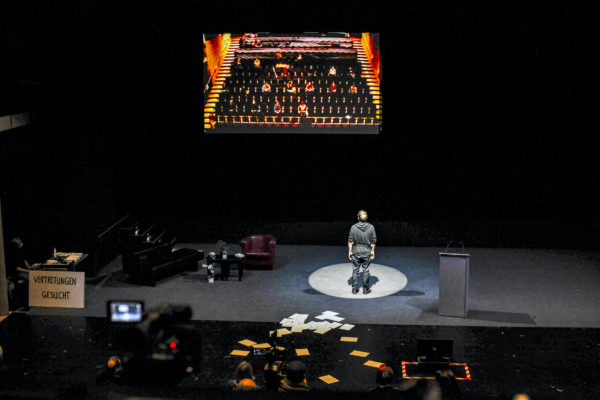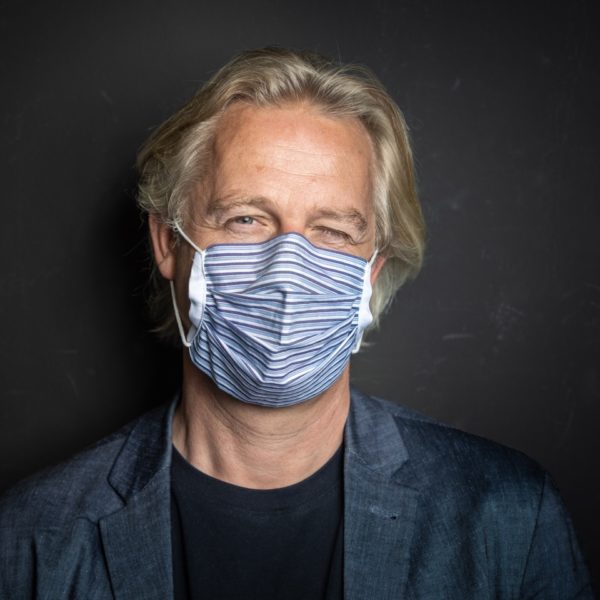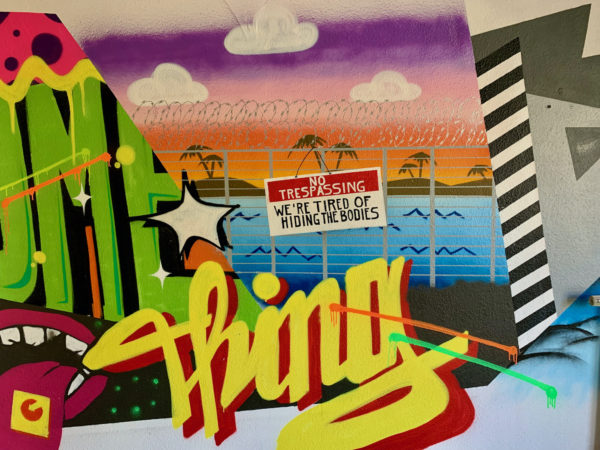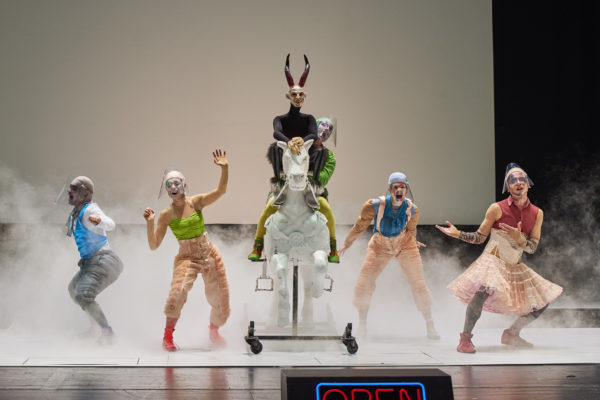In
seinen Erinnerungen »Zeitfäden«
ergründet
Peter Brook die Wurzeln des Kreativen. Er findet sie im ererbten
Kampf »zwischen
Energie, Impulsivität
und Entschlusskraft einerseits und dem Bedürfnis
nach Gleichgewicht und Ausgleich«.
Aus der Balance dieser Elemente bezieht das universelle Theater des
1925 in London geborenen, seit acht Jahrzehnten wirkenden Brook seine
Wahrhaftigkeit. Sperrbezirke kennt es nicht. Integriert sind
Probenerleben, Zufälle,
Alltagswahrnehmung, außereuropäische
Literaturen, Ich und Welt und Wir.
»The
Prisoner«
(Text
und Regie: Brook und Marie-Hélène
Estienne) zeigt bei den Ruhrfestspielen den
legendären
Künstler
als Beckett-Bewunderer und Kafka-Leser. Irgendwo sitzt ein Mann,
Mavuso, allein vor einem Gefängnis,
das eher das Verlies seines Inneren ist. In der theatralen Recherche
zur Idee der Freiheit (koproduziert mit dem Théâtre
des Bouffes du Nord Paris) bleibt offen, wer er ist, was sein
Vergehen oder seine Schuld, ob er sich dort freiwillig oder
erzwungen, als Strafe oder willentliche Sühne
aufhält.
Sucht er Erlösung
und Vergebung?
Für
Brook bedeutet die Einladung ins Ruhrgebiet auch eine Rückkehr,
nachdem Gerard Mortier ihn 2004 zur Ruhrtriennale holte und auch die
Ruhrfestspiele bereits eine seiner Produktionen im Programm hatten.
Der neue Intendant Olaf Kröck
in Recklinghausen legt, indem er diesem Zeugen und Heroen des
Jahrhunderts eine Hommage ausrichtet, ein Bekenntnis zur Tradition
ab.
Das Denken als körperlicher Vorgang
1981
hat die Fotografin Annie Leibovitz Peter Brook in seinem Pariser
Theater porträtiert:
als lehmfarbenen Beduinen der Bühne.
Ein Nomade, der die Leere liebt –
den
Himmel über
der Wüste.
»Der
leere Raum«
heißt
Brooks berühmte,
viel zitierte Anleitung für
das Theater von 1968. Ein Konzept, das jedoch nur in seiner Belebung
funktioniert: Das Denken ist ein körperlicher
Vorgang.
Brook
–
beeinflusst
durch Shakespeare, Artaud, Brecht und Grotowski –
hat
Filme gedreht, Opern inszeniert, hat geschrieben, die Royal
Shakespeare Company geleitet und eigene Gruppen gegründet.
Früh
wurde ihm die Notwendigkeit eines festen Ensembles bewusst, das –
mit
so unterschiedlichen Mitgliedern wie dem Deutschen David Bennent, dem
Japaner Yoshi Oida, dem Amerikaner Bruce Myers –
ein
Instrument für
Improvisation bildet. Fantasie entsteht nie nur intellektuell.
Realismus oder Stilisierung sind nur künstliche
Konventionen. Gedanken wie diese prägen
Brook, seine Experimente und Forschungen: Erlerntes verlernen, immer
wieder neu anfangen, den Ballast von Fertigkeiten abwerfen, auf Dekor
und Effekt verzichten, sich mit vokaler Rhythmik, mit Laut, Tanz und
Bewegung artikulieren und Sprache nur als ein Element unter anderen
verstehen.
In
seinem mobilen Welt-Theater liegt »hinter
den Zeichen«
die
Natur des Menschen: wenn er den Kontinent Shakespeare und immer
wieder »Hamlet«
erkundete,
»Carmens«
Tragödie
in einer Sand-Arena einrichtete, in Oliver Sacks’
neurologischen
Fallstudien die Frage nach der Wahrnehmung von Realität
und dem Unergründlichen
des scheinbar normalen Alltags stellte oder das mythische
»Mahabharata«,
Indiens Nationalepos, der Bühne
anverwandelte. Mit der puren Konzentration auf den Akteur und dem
Reflektieren eigenen ursprünglichen
Tuns: zu spielen und sich (Be-)Deutungsschwere zu entheben, hat Brook
das Theater entscheidend geprägt.
Das Fremde wird vertraut –
und
umgekehrt. Peter Brooks Kunst gelingt, wie ein offenes Geheimnis
auszusehen.
9.
bis 12. Mai 2019,
Ruhrfestspiel-Haus Recklinghausen, Kleine Bühne.