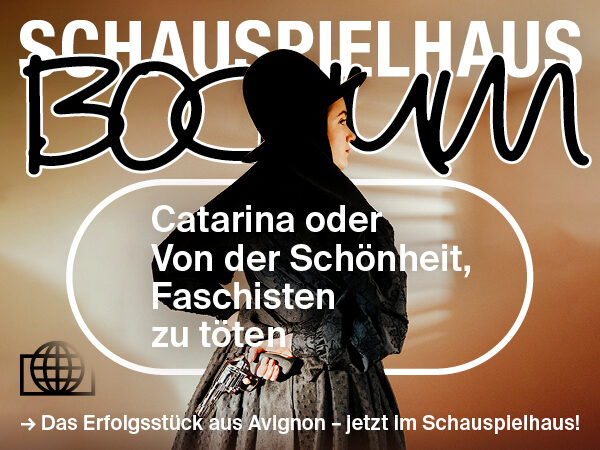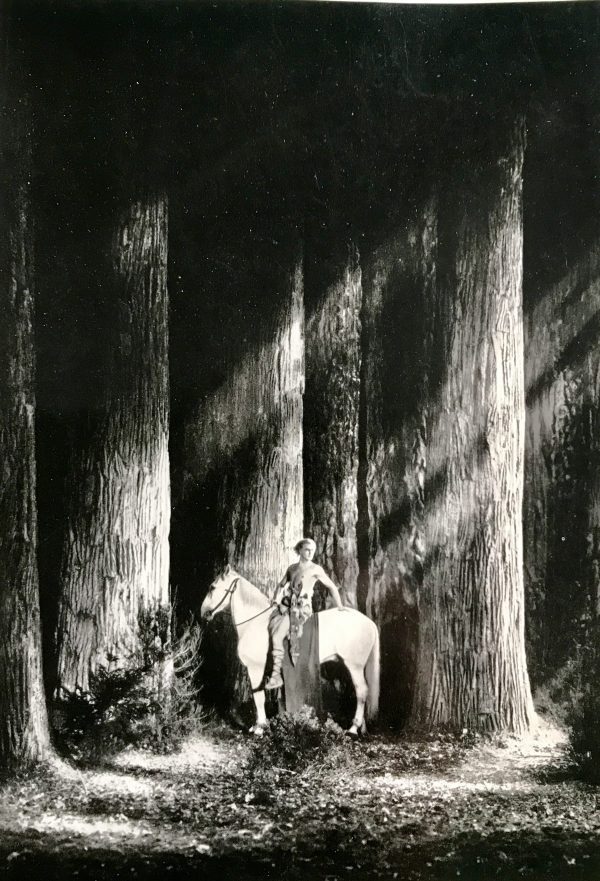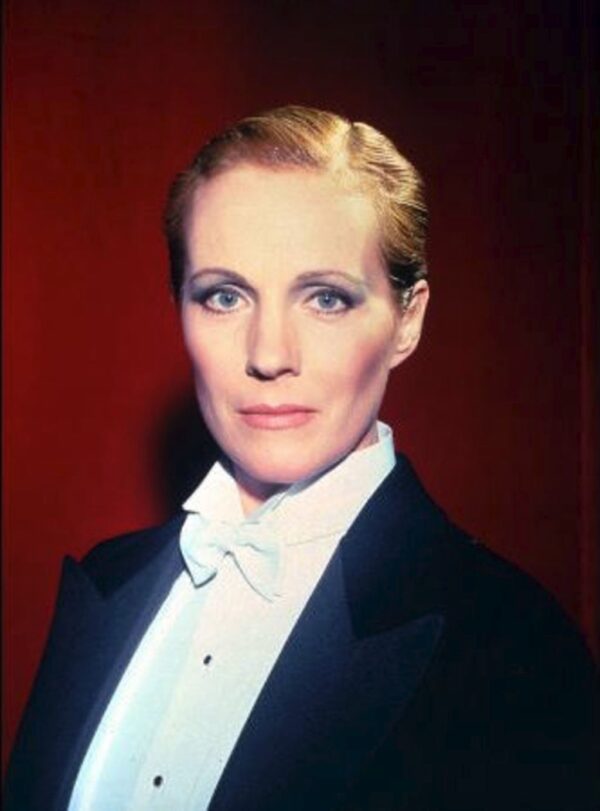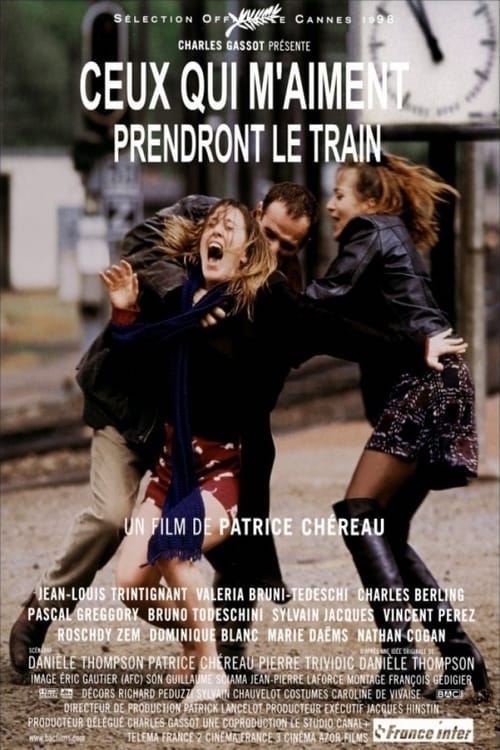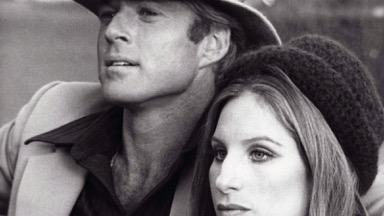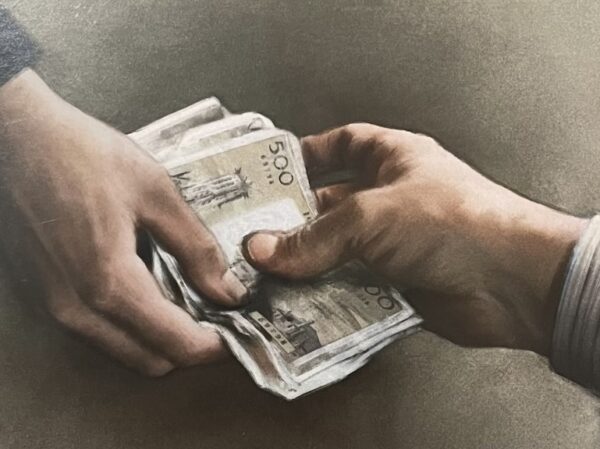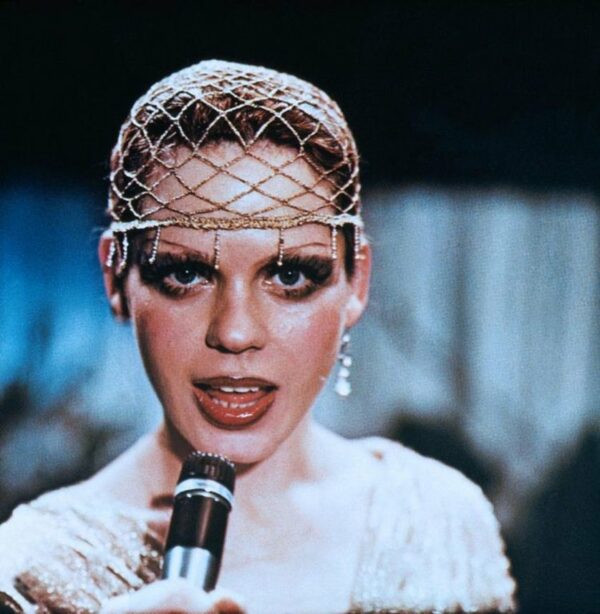Wir wollen nicht vom Kino ablenken, sondern zum Kino hinlenken, zu dem, was es war und – wieder – ist. Regelmäßig, bereits zum 47. Mal, stellen wir einen Klassiker des deutschen und internationalen Films vor, der nicht immer zum Kanon gehört, aber eine Rarität und Kostbarkeit ist. Bei einem der Anbieter lassen sie sich ausleihen, als DVD kaufen, zur Not bei YouTube besichtigen. Nur Netflix-Serien zu schauen, verengt den Blick.
»Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung.« Schreibt Thomas Brasch. Die Literatur erzählt von solchen Rebellionen: gegen Unrecht und Ungleichheit, für das Ich oder für das große Ganze, in moralischer oder amoralischer, politischer, erotischer oder ästhetischer Hinsicht. Ob Kleists Michael Kohlhaas, Büchners Woyzeck oder Döblins Franz Biberkopf, ob Nabokovs Humbert Humbert oder Thomas Manns Felix Krull, die alle in glücklicher oder unglücklicherer Weise auf die Leinwand gefunden haben.
Der Kriminelle ist auf seine Art Künstlernatur. Nehmen wir den von Patricia Highsmith durch fünf Romane geführten Tom Ripley. Ein verführerisches Beispiel sozialer Mobilität und fluider Identität. Leben als Maskenspiel. Sein erster Mord ist der an Dickie Greenleaf, den er auf einem Boot erschlägt. Weitere folgen. Zu Vermögen gekommen, wird er fortan ungestraft ein Doppelleben führen. Und in Harmonie mit sich leben. Keine Ich-Krise, sondern totale Selbstannahme. Verbrechen lohnt sich. Der Verbrecher ist mit sich im Reinen.
Insofern ist die glanzvollste Ripley-Verfilmung auch die verfehlteste: Anthony Minghellas in den Farben und Mustern der fünfziger Jahre und in Italiens Schönheit mit Amalfi-Küste, Rom und Venedig manieristisch schwelgender und flirrender »Der talentierte Mr. Ripley« von 1999. Anders etwa als René Clements spröde Verfilmung von 1960, »Nur die Sonne war Zeuge«, die den ohnehin stets in seiner Wirkung ambivalenten, im Zwielicht dunkel leuchtenden Charakter Alain Delons ideal als Ripley zeigt.
Matt Damon bei Minghella hingegen hat zunächst den Zuschnitt eines bieder-normalen, ungelenken All-American-Boys mit College-Brille. Aber er legt buchstäblich seine Blässe ab und kopiert ‚Dickies’ (Jude Law) smart-sinnliche, skrupellose, dem Genuss lebende Haltung und Anmutung perfekt. Sein Imitation Game. Attraktivität durch artistisches Agieren. Minghella schenkt seinem Ripley keine Ruhe, treibt ihn durch sein Schicksal – das ist richtig und rasant inszeniert.
Der erste Ripley-Roman erschien Mitte der fünfziger Jahre, ebenso wie Max Frischs »Stiller« und die »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull«: drei Außenseiter, in ihrer Existenz fragwürdig, ohne festen Umriss. Sie »probieren Geschichten an wie Kleider«, heißt es bei Frisch an anderer Stelle.
In seiner Entwicklung und gegen Ende des Films immer deutlicher, bis er schließlich wieder auf dem Meer ist, wird der Highsmith-Held von Minghella umgeformt. Die Ripley spürbar umgebende Einsamkeit macht ihn hier nicht stark und unverwundbar, sondern Schuldgefühl und Reue schwächen ihn und konstruieren seine Selbstverneinung. Er spürt sein Ich-Gefängnis. In Spiegelbildern blickt ihm sein isoliertes Ich entgegen. So ist Tom Ripley beinahe eine zerrissene Dostojewski-Figur.