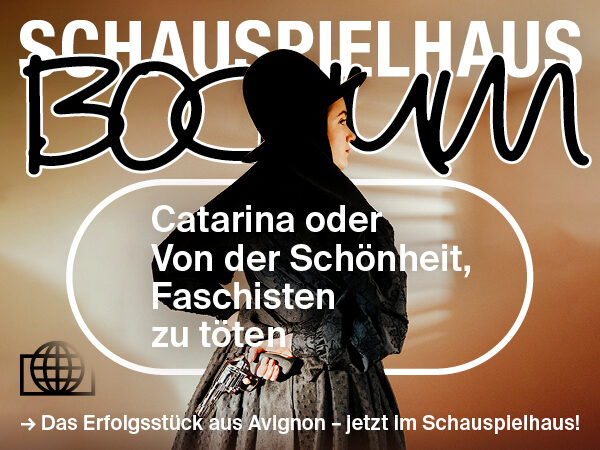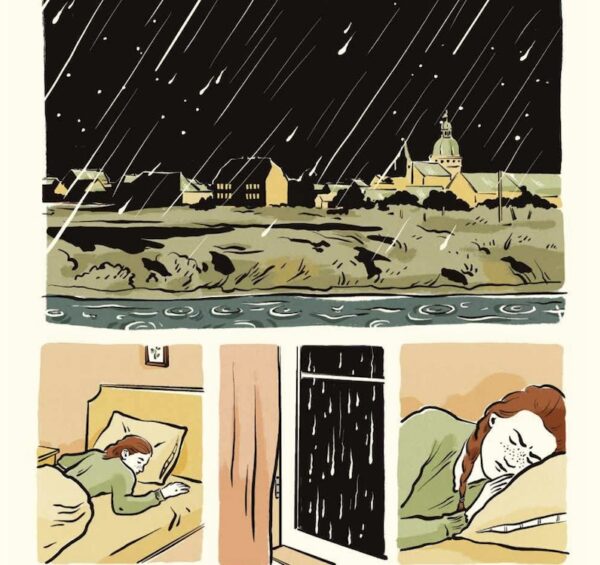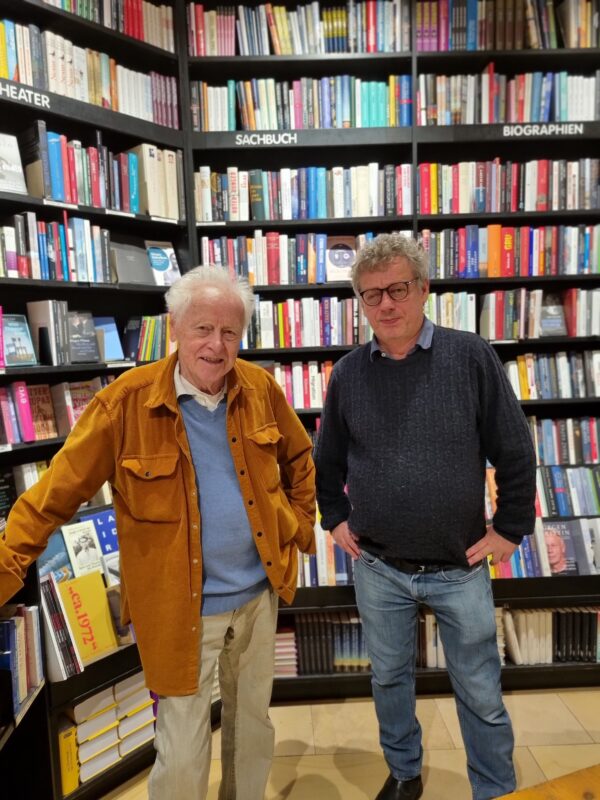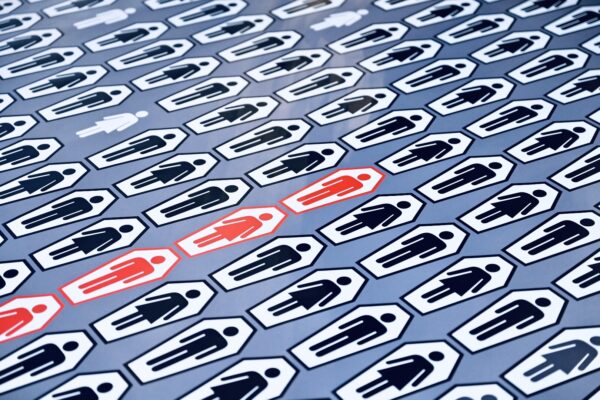Mitten im Ruhrgebiet steht ein Haus, das seit über 100 Jahren ein wichtiges Zentrum für Polen in Deutschland war – und nach seiner Sanierung wieder werden soll: Dom Polski.
Auf der Bochumer Straße, die heute Am Kortländer heißt, wurde bis zum Zweiten Weltkrieg fast nur Polnisch gesprochen. Damals hieß sie noch Klosterstraße, wurde aber auch »Klein-Warschau« genannt und war praktisch komplett in polnischer Hand: »Rund 25 polnische Organisationen hatten hier ihren Sitz – vom Bäcker bis zur Bank über kirchliche Organisationen oder Gewerkschaften«, weiß Jacek Barski, Geschäftsführer der Dokumentationsstelle Porta Polonica zur Kultur und Geschichte der Pol*innen in Deutschland mit Sitz in Bochum. Ein besonders geschichtsträchtiges Haus auf dieser Straße soll jetzt renoviert und wieder ein wichtiges Zentrum polnischen Lebens in Deutschland werden.
Dieses Haus, das seit über 100 Jahren eine wichtige Rolle in der deutsch-polnischen Geschichte spielt, heißt Dom Polski (»Polnisches Haus«). Im vergangenen Herbst wurde es endlich aus seinem langen Dornröschenschlaf wachgeküsst und soll nach einer millionenschweren Sanierung mit Mitteln des Bundes und des Landes NRW ab 2026 wieder zum Leben erwachen. Dass Bund und Land Geld geben haben, hat auch mit weiter bestehenden polnischen Reparationsforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun.

»Die Bochumer nannten die Klosterstraße ‚Polnischer Querschlag‘ oder ‚Klein-Warschau‘«, erklärt Jacek Barski. »Für die polnischen Migranten wurde sie allerdings zur Kuźnia Bochumska, also zur Bochumer (Kader-)Schmiede.« Sie sei ein Symbol des polnischen Lebens im Ruhrgebiet und in Deutschland gewesen. In ihrem Umfeld konnten polnische Eliten und Aktivisten quasi geschmiedet werden – wie zum Beispiel der Politiker Jan Kaczmarek, der einer der bekanntesten Repräsentanten der Polen in Deutschland wurde, die damals noch den Status einer Minderheit im Land hatten. Kaczmarek wurde unter anderem bekannt als Führungsfigur des Bundes der Polen in Deutschland.
Gegründet wurde er 1922 in Berlin. Damit ist er die älteste Minderheitenorganisation in Deutschland. Im Ruhrgebiet war er immer besonders mitgliederstark und hat heute auch seinen Sitz in Bochum. Der ist allerdings im Moment noch eine Baustelle – er ist nämlich im Dom Polski, das gerade ja saniert wird.
Politisch würde der Bund der Polen in Deutschland gerne erreichen, dass die im Land lebenden Polen wieder einen Minderheitenstatus zugesprochen bekommen. Mitte der 1920er Jahre, als das noch der Fall war, wiesen Statistiken in Deutschland rund 200.000 Menschen mit polnischer Muttersprache aus, rund 60.000 waren vor dem Zweiten Weltkrieg im Bund organisiert, dessen Vorsitzender heute Josef Malinowski ist: »Bis 1940 gab es den Minderheitenstatus für Polen in Deutschland«, sagt er. Welch ein starkes Zeichen der Bund der Polen in Deutschland noch 1938, also kurz vor Kriegsbeginn, setzte, kann man eindrucksvoll auf der Internetseite der Dokumentationsstelle Porta Polonica sehen: Zum Kongress der Polen in Deutschland kamen 5000 Delegierte nach Berlin und marschierten mit Flaggen auf, deren Symbole eine eindeutige Antwort auf das Hakenkreuz der Nationalsozialisten waren.
Noch Ende September 1939, nach dem deutschen Überfall auf Polen, wurden Polen überall im Land enteignet. Das geschah auch mit allen Immobilien, die an der Bochumer Klosterstraße der polnischen Minderheit gehörten – die Eintragungen in den Grundbüchern wurden auf neue deutsche Eigentümer umgeschrieben. Die damalige Geheime Staatspolizei (Gestapo) hat Dom Polski in Bochum bereits Mitte September 1939 durchsucht, Dokumente und Materialien konfisziert und teilweise sofort vernichtet. Funktionäre und Mitglieder des Bundes der Polen in Deutschland wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht, viele sind dort umgekommen.
Dom Polski, das Polnische Haus, blieb allerdings nach dem Krieg in polnischem Besitz und konnte in den 1960er Jahren erstmals notdürftig renoviert werden. »1991 gab es Vereinbarungen zwischen Polen und Deutschland: Damals wurden uns alle Rechte zugesichert, die die deutsche Minderheit in Polen hat«, sagt Josef Malinowski. »Diese Vereinbarung, die eigentlich einem Gesetz gleichkommt, wurde aber nicht umgesetzt.« So sieht er die Sanierung von Dom Polski, für die sich auch der ehemalige polnische Außenminister, Szymon Andrzej Szynkowski vel Sęk von der PiS-Partei, stark gemacht hat und die sich Bund und Land NRW jetzt 2,4 Millionen Euro kosten lassen, zwar als »sehr positives Beispiel« für deutsches Engagement in der Sache. »Aber wir betrachten es nur als ein Stück Wiedergutmachung«.
Ort der Begegnung und Erinnerung
Vor bald zehn Jahren begannen die Verhandlungen über die umfassende Sanierung des Polnischen Hauses in Bochum. Seit 2016 hängt ein Banner an der Fassade, das ankündigt, dass hier bald »Porta Polonica« einziehen soll. »Die Dokumentationsstelle ist vor elf Jahren gegründet worden aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestags zur Wiedergutmachung der deutschen Verbrechen gegen Polen im Zweiten Weltkrieg«, erklärt Geschäftsführer Jacek Barski. »Die Trägerschaft sollte ein Museum übernehmen, das sich mit Migration beschäftigt und im Ruhrgebiet liegt.« Das hat man gefunden: Es ist die Zeche Hannover in Bochum, eine Abteilung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Dortmund, die sich schon lange auch der Geschichte der Ruhr-Polen widmet.
Die Raumbedürfnisse von Porta Polonica sind in den vergangenen acht Jahren allerdings gewachsen, so dass eine Unterbringung im Dom Polski nicht mehr in Frage kommt. »Wir sind aber ja praktisch Nachbarn in der Stadt und dem Haus sehr verbunden«, sagt Barski. »Wir werden die Räumlichkeiten unter anderem mit Ausstellungen bespielen.« Weitere Pläne hat der Bund der Polen in Deutschland, der seine Zentrale im Haus einrichtet und Gesellschaft von weiteren Organisationen polnischen Lebens bekommen wird – zum Beispiel dem Christlichen Zentrum für Kulturtradition und polnische Sprache, der Polnischen Zentrale für Schul- und Bildungswesen, die sich mit Muttersprache, Kultur und Geschichte beschäftigt, oder dem Verein der polnischen Ingenieure.
»Dom Polski wird ein Ort der Begegnung und Erinnerung, der Verständigung zwischen Deutschen und Polen, polnischer und deutscher Kultur«, sagt Josef Malinowski. »Die ganze Straße lebte vor dem Krieg von offenen Veranstaltungen – alle ansässigen Organisationen haben mitgespielt.« Deshalb wünscht er sich, dass nicht nur polnisch-stämmige Menschen, sondern auch viele weitere Bochumer Bürger*innen mit (und ohne) Migrationshintergrund am Geschehen im Haus mitwirken. Im Erdgeschoss wird es dafür einen öffentlichen Bereich mit einer kleinen Dauerausstellung und Platz für Schulungen und kleine und mittlere Versammlungen geben.
Bis zu drei Stellen sollen eingerichtet werden für Mitarbeiter*innen, die für Veranstaltungs- und Bildungs-Programm sorgen. »Außerdem wird es ein Residenzprogramm geben für Wissenschaftler, deren Aufenthalt und Forschungsprojekte gefördert werden«, sagt der Vorsitzende. Also werden auch in Zukunft wichtige Impulse für die Achse Polen-Deutschland von Bochum ausgehen. Und vielleicht wird auch die Achse Bochum-Berlin wieder belebt, wenn in der Hauptstadt das Projekt eines Deutsch-Polnischen Hauses gedeiht.