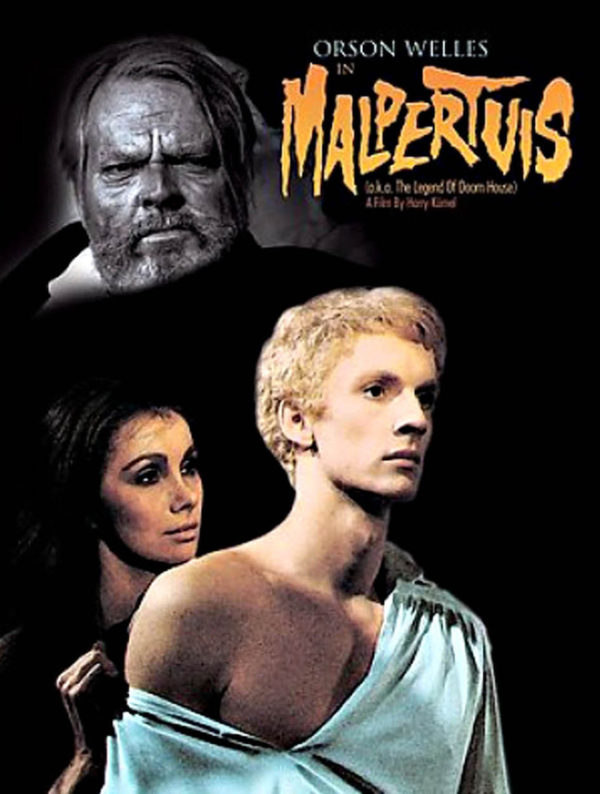Wir wollen nicht vom Kino ablenken, sondern zum Kino hinlenken, zu dem, was es war und – wieder – ist. Bereits zum 49. Mal stellen wir einen Klassiker des deutschen und internationalen Films vor, der nicht immer zum Kanon gehört, aber eine Rarität und Kostbarkeit ist. Bei einem der Anbieter lassen sie sich ausleihen, als DVD kaufen, zur Not bei YouTube besichtigen. Nur Netflix-Serien zu schauen, verengt den Blick.
Es geht Hand in Hand. Hände in Großaufnahme, immer wieder, verleihen dem Film Struktur und bilden gewissermaßen seine symbolische und konkrete Verkehrsform. Das Grund- und Urmotiv aus Richard Wagners »Ring«-Erzählung beschäftigt auch Robert Bresson in seinem essentiell puristischen Film »L’Argent«. Geld und Glück, Gier und göttliches Gebot – diese Gleichungen gehen nicht auf.
Geldscheine werden hingeblättert, gefälscht, verliehen, eingetauscht, gezählt, ausgezahlt, gestohlen. Das hat Methode und System – und als kapitalistisch-monetärer Kreislauf Folgen. Das menschliche Laster, bei dem gläubigen Katholiken Bresson (1901-1999) und Regisseur des »Prozess der Jeanne d’Arc« durchaus im Sinn der biblischen Todsünden gemeint, breitet sich aus wie eine Seuche. Alle an dem ursprünglichen Vor- und Sündenfall Beteiligten, mitschuldig aus Unterlassung, Vorteilsdenken oder um eigene Verfehlungen zu vertuschen, werden im Verlauf der Geschichte, die der französische Regisseur einer Novelle von Lew Tolstoi entlehnt hat, im doppelten Sinn weiterverfolgt.
Im Sog der Fatalität
Yvon, ein junger Mann, Tankwagenfahrer, Ehemann und Vater (Christian Patey), will ahnungs- und schuldlos mit einer gefälschten 500-Francs-Note, die zuvor durch mehrere Hände gegangen ist, seine Restaurantrechnung begleichen. Doch die Polizei glaubt ihm nicht, weil einige beteiligte Zeugen Falschaussagen machen, so dass Yvon seinen guten Namen verliert und von seiner Firma entlassen wird. Nun gerät sein Leben aus der Balance und in den Sog der Fatalität. Seine kleine Tochter Yvette stirbt an Diphterie, seine verzweifelte Frau verlässt ihn. Nach einem missglückten Banküberfall wird er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Dort gelingt es ihm, standhaft zu bleiben, sich einer weiteren Gewalttat zu enthalten und mit gut Glück entlassen zu werden. Kaum aber in Freiheit, wird er zum Räuber und Mörder, bringt ein Hotelier-Ehepaar um und schließlich in einem abgelegenen Haus eine fürsorgliche alte Dame (Sylvie van den Elsen) samt Familie, die sich seiner angenommen hat und bei der er durchaus mit Zuneigung zu ihr einige Tage verbracht hat. Danach stellt sich Yvon der Polizei. Als er abgeführt wird, zeigt uns Bressons Kamera die Menge von Leuten, die den Vorgang beobachten, nur als zusammengedrängt gesichtslose Schatten. Niemand ist für jemand da.
Bresson inszeniert mit äußerster Zurückhaltung, ohne Interesse an Elementen des Thrillers oder Kriminalfilms, ganz konzentriert auf die innere Mechanik dessen, worum es geht: Gewalt und gesellschaftliche Gleichgültigkeit und Kälte, die durch die abstrakte Größe Geld angestiftet werden. Seine Interpret*innen, allesamt Laiendarsteller*innen, erlauben gerade deshalb keinerlei Ablenkung vom Sinnen und Trachten ihrer Figuren. Der Film hält auf Abstand und schafft eben so seinen bestürzenden Ausdruck. Bresson habe, schreibt Susan Sontag, »eine Form entwickelt, die das, was er sagen will, vollkommen ausdrückt und unterstreicht« und dabei »identisch« sei mit ihm.