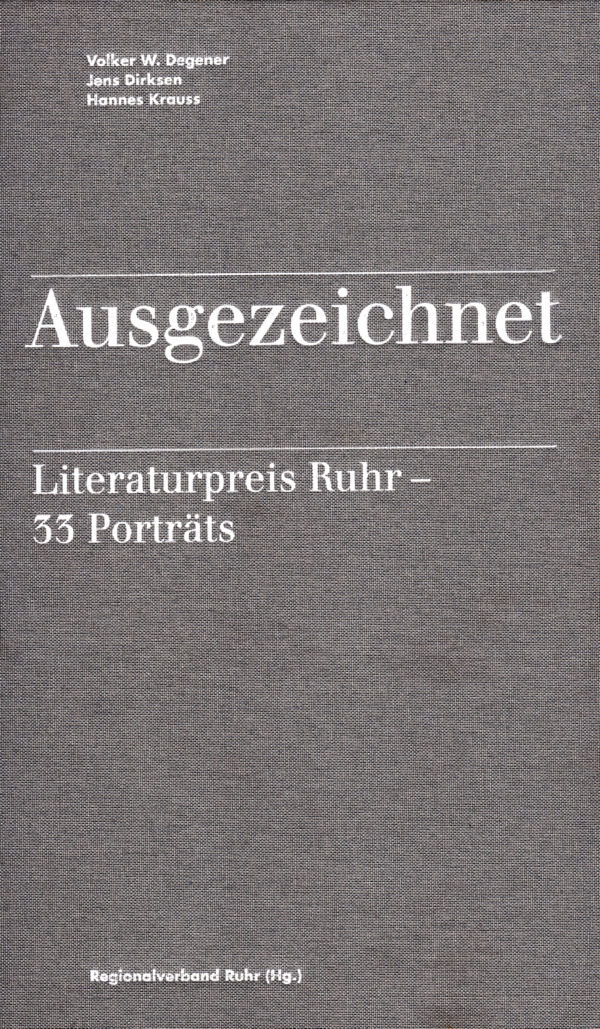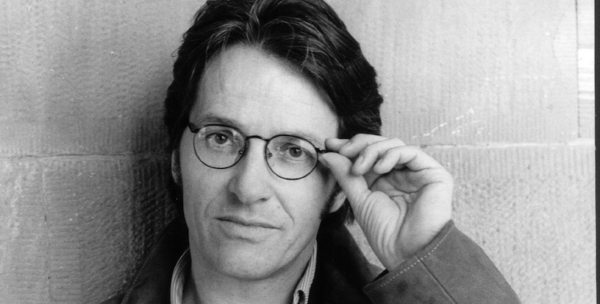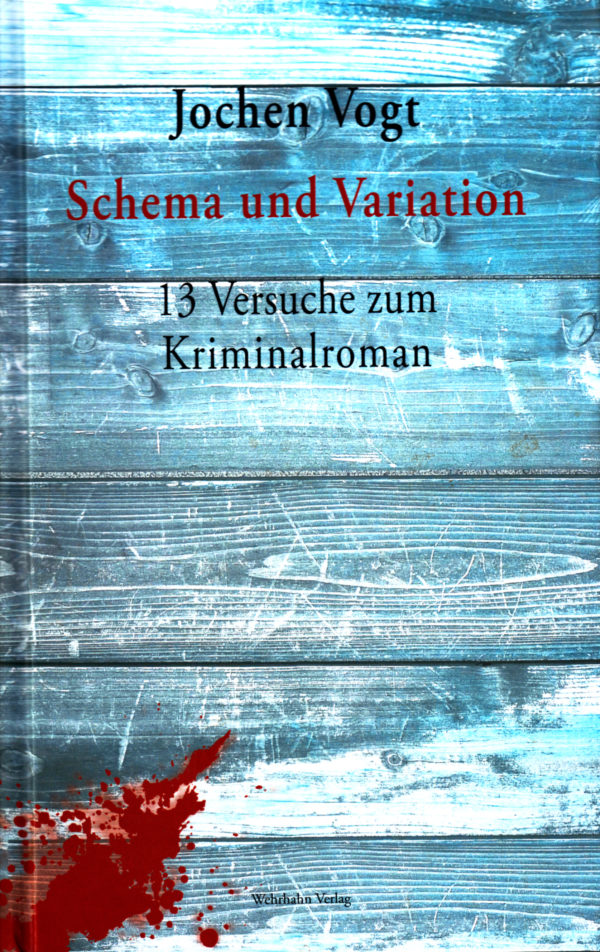Elf Geschichten, elf Meistererzählungen. Und ausgerechnet der Text, der am weitesten entfernt zu sein scheint vom Autor, seiner Zeit und seinem Raum, seiner Vergangenheit und Gegenwart, der Jugend im Ruhrgebiet und der Berliner Wirklichkeit, der zurückreicht bis in die von der Mauer geteilte Stadt, gibt dem Band seinen Titel: »Hotel der Schlaflosen«. Ein wunderbarer Titel, denn das Unnahbare und Anonyme, das jedem ‚Fremdenzimmer’ eines Hotels innewohnt und dennoch Aura zu entwickeln vermag, die in eben diesem Befremden über scheinbar Vertrautes liegt, passt für Ralf Rothmanns Schreiben. Ein taghelles Schreiben, das sich von der Nacht berühren lässt, seit dem Roman-Debüt »Stier« des 1953 in Schleswig geborenen und in Oberhausen aufgewachsenen Schriftstellers, den es dann nach Berlin zog.
Seltsam, beim Lesen jedes seiner Bücher fragt man sich, wie viel biografische Füllung in dem ‚Fabelhaften’ liegt, kaum verborgen zu liegen scheint. Der sich dem Kind einverleibte Schmerz durch die Schläge der Mutter, die unduldsam und nervös ist oder »ihren Melancholischen« hat, der ‚Onkel’ mit dem Bestattungsunternehmen und den Schwielen auf der Seele, der Melker auf dem Bauernhof im Norden, die Familie mit ihrem Ernährer, der unter Tage malocht, ohne dass der Ruß in den Rillen der Haut seinen Feinsinn hätte ganz ersticken können, der Maurer auf dem Bau, den eine andere Zukunft erwartet, und der Polier, der keine andere mehr hat, der Schluri im West-Berlin der ewigen Studenten, der in der Liebe und ihren Riten versierte und versehrte Mann, dem sich sein romantisches Gefühl in den stillen Sensationen der Natur spiegelt – das sind uns vertraute Figuren und Konstellationen der Rothmann-Welt.
Rau, ruppig, rüde
Die Präzision in der Beobachtung und die sprachliche Grandezza, egal, welchen Tonfall, hoch oder niedrig, alternativ oder proletarisch, rau, ruppig und rüde oder von nachschwingender Zartheit, er anstimmt, die Anmut im Beschreiben von Menschen, die Sogkraft, die mit dem ersten Satz einsetzt, das Inszenieren einer Situation – das macht ihm keiner nach.
Neben der Liebe und anderem Lebensglück und Lebensunglück hat Rothmann eine Schwäche für den Tod, und jenen, die »diesen einen Schritt über alles hinaus« tun – selbst verantwortet oder als jähes Verhängnis. Durch Folter und Hinrichtung in einem stalinistischen Gefängnis, wo sich uns der Mord an dem Dichter Isaak Babel aus der Perspektive des Henkers auftut, der ein guter Kerl ist und seiner Arbeit nachgeht. Oder als sterbenstraurige Wiederbegegnung von Sohn und Vater im Angesicht eines von Vitriol konservierten Leichnams, ähnlich wie in Johann Peters Hebels »Unverhofftes Wiedersehen«. Es mag kein Zufall, sein, dass mit »Der Wodka des Bestatters« Rothmann und Hebel in konkurrenzlosen Wettbewerb treten, der keinen Unterlegenen kennt.
Nahezu lautlos, innig-wehe, doch unsentimental, erschütternd sachlich und konkret betrachtet Rothmann das Sterben und erweist dem Tod so wahrhaft die letzte Ehre. Das »leise Ziehen in der Herzgegend«, mit dem das Buch in einer nur fünfseitigen Erzählung abschließt, die mit dem Irrlauf der Erinnerns, dem Richtigen im Falschen und dem Verkehrten im Wirklich-Gewesenen spielt, bleibt das Grundgefühl in Rothmanns Geschichten – und bei ihrem Leser. Erinnerung findet sich nicht, in dem jemand von der Hauptstraße abbiegt und einen Umweg fährt, nicht auf der Landkarte, sondern andernorts. Den Zutritt, ja, den geheimen Zugang, dazu besitzt Ralf Rothmann.

Ralf Rothmann, »Hotel der Schlaflosen«, Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, geb., 205 Seiten, 22 Euro