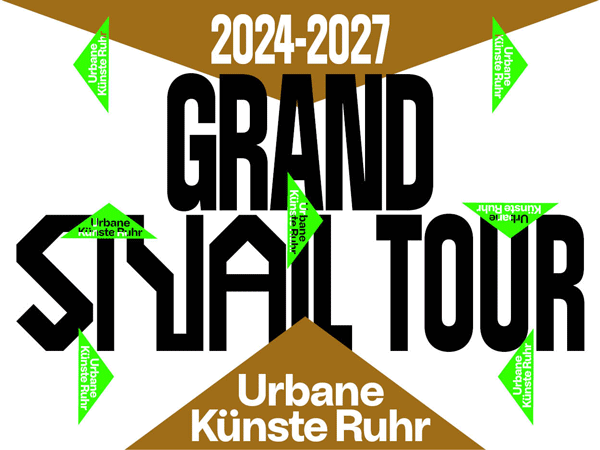Kirill Serebrennikow verfilmt eindrücklich »Das Verschwinden des Josef Mengele«. Der »Todesengel« von Auschwitz entkam über die »Rattenlinie« nach Südamerika. In der Hauptrolle überzeugt August Diehl.
Kirill Serebrennikows eindrücklicher Film bewegt sich zwischen zwei Polen: einem unsichtbaren und einem sichtbaren. Ersterer bezieht sich auf das Motto, das der Vorlage, dem Roman von Oliver Guez, als Motto voransteht. Es stammt von Guez’ Schriftstellerkollegen Czeslaw Milosz und lautet stark und knapp wie in biblischer Wucht: »Fühlt euch nicht sicher. Der Dichter erinnert sich.« In Nachfolge des Autors übernimmt der Regisseur diese Aufgabe des Erinnerns an die Geschichte des Josef Mengele, des, wie man ihn genannt hat, »Todesengels« von Auschwitz, und seiner jedenfalls vor Recht und Gericht ungesühnten Taten. Man darf vielleicht sogar fragen, ob der Dichter in diesem Sinn nicht auch Stellvertreter Gottes auf Erden sei.
Den zweiten Pol bildet eine Sequenz in dem brillant fotografierten Schwarzweiß-Film »Das Verschwinden des Josef Mengele«. Wie man es von dem im deutschen Exil lebenden russischen Bühnen- und Filmkünstler Serebrennikow kennt, dessen Filme ihr moralisches Anliegen mit ästhetischen Mitteln zu umkleiden oder auch zu überwältigen suchen, ist sie als ausschweifendes Delirium inszeniert und wie für ein Musikvideo montiert: eine Rückblende als farbige Fantasie und bluttrunkene Operette über den Täteralltag der Lager und ihr grausiges Handeln. Für die Opfer die Hölle auf Erden, für ihre Peiniger ein Paradies der Allmacht.
Kaleidoskophafte Erzählung
Mengele entkam dank Helfershelfern 1945 dem verwüsteten europäischen Kriegskontinent über die »Rattenlinie« nach Südamerika. Dort wird er, ankommend in Buenos Aires als Niemand unter dem falschen Namen Gregor Bauer, nach mehr als drei Jahrzehnten – abgesehen von dem unbehelligten Rückkehrbesuch in die bayerische Heimat und zu seiner im Wirtschaftswunder satt gewordenen Familie und dem sie dominierenden Vater (Burghart Klaußner) – 1979 in Brasilien sterben. Auch Argentinien hatte er nach dem Sturz des Regimes von Péron verlassen müssen.
Die Realität wird ihn weiterverfolgen und einholen: darunter Eichmanns Entführung und der mit dem Todesurteil endende Prozess gegen den Schreibtischtäter und Organisator der Deportationen in Jerusalem 1961, und die Auseinandersetzung mit seinem Sohn Rolf, der ihn mit Fragen konfrontiert und diesen abgründigen Charakter zum Blick in den Spiegel nötigt. Insofern ist auch in dieser Hinsicht Mengele, der seine zweite Frau (Friederike Becht) in Uruguay heiratet, als ein Getriebener auf der Flucht. Seine Paranoia hat rationale Ursache.
Die kaleidoskophafte Erzählung in ihrer bohrend psychodynamischen Intensität ist mehreres: Gerichtstag über den Massenmörder und historische Betrachtung, Familiendrama sowie Reflexion über das Selbstverhältnis eines Mannes, der seine Identität wechseln muss und dessen verhärteter Ich-Kern darüber zersplittert. Dieser Mengele hier ist gewissermaßen ein in die absolute Negation getriebener Peer Gynt: Er ist sich selbst genug, unfähig zur Empathie, gewissenlos, den Kontinuitäten eines Lebens unterm Hakenkreuz nachgehend. Nur die Hülle eines Menschen, ganz gleich, wie er sich nennt, wie man ihn nennt, ob im Glanz oder im Elend seiner letzten Station in Sao Paulo.
August Diehl verleibt sich – Jahre und Jahrzehnte der Figur auflegend, während in seinem Gesicht sich die Maske ablöst – diesen furchtbaren Mediziner, der seine monströsen Experimente hinter wissenschaftlichem Interesse abschottete, mit überwältigend spielerischem Engagement ein, so dass man an den ganz jungen Schauspieler vor gut 25 Jahren in Sarah Kanes / Peter Zadeks »Gesäubert« denken muss. Auf das Heißlaufen und Überkochen des Stoffs und seiner auskühlenden Gestaltung reagiert er mit seiner genau temperierten Darstellung. ****
»Das Verschwinden des Josef Mengele«, Kirill Serebrennikow, 135 Min., D / F 2025,
Start: 23. Oktober 2025