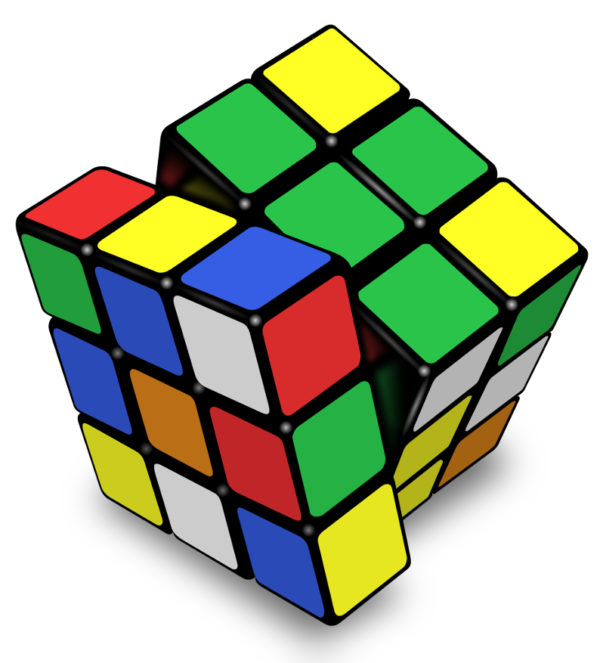Zugegeben, es war diesmal etwas kniffelig, das Thema dieser Kolumne an den Themenschwerpunkt anzubinden. Was kann man »aufschieben«? Zahnarztbesuche? Schiebetüren? Halden? Alles nicht das Gelbe vom Ei. Dass wir auf die Schublade, diesem echten Stück Design im Alltag kamen, haben wir auch der Bevölkerung der Romandie, der französischsprachigen Schweiz, zu verdanken. Dort wird das Verb »schubladiser« verwendet, was so viel wie »zu den Akten legen« oder »auf die lange Bank schieben« bedeutet. Perfekt, so kommt man über prokrastinative Aspekte zu jenen oben offenen Behältnissen zum Schieben und Ziehen, die in jedem Haushalt in mannigfacher Gestalt zu finden sind – den Schubladen.
Massive Kommoden, quadratische Zettelkästen

Foto: Wikicommons/public domain
Wer einst auf die Idee kam, die erste Schublade zu konstruieren, ist im Dunkel der Geschichte schwer auszumachen. Auch wenn in den ersten Höhlen eine Kommode praktisch und schick anzusehen gewesen wäre, musste man als Menschheit wahrscheinlich erst auf die Freuden der Holzverarbeitung und des Hausbaus warten. Spätestens mit der Erfindung der Herrensocke sollte es soweit gewesen sein, entsprechende Behältnisse zur Stauraumgewinnung zu zimmern. Seitdem gibt es Schubladen quer durch alle Moden und Designstile. Große, schwere Modelle in massiven Kommoden, quadratische Schublädchen für Zettelkästen oder zusammengeraffelte Besteckschubladen. Verziert mit Griffen und Knäufen aus Kunststoffen, Metall oder Holz – wenngleich wohl Knaufkritiker die versteckte Griffleiste bevorzugen.
Auch Marie Kondō hilft nicht weiter
Ordentlich eingeräumte Schubladen sind zwar möglich, aber im Alltag nicht oft anzutreffen. Da kann man noch so viele Bestseller der Fachaufräumerin Marie Kondō lesen, eifrig ausmisten und sein Zeug nach Kategorien einräumen – eine unsichtbare Kraft scheint die Schubladen wieder unordentlich zu machen. Mindestens eine dieser Schubladen hat jeder Haushalt, eine Art Müllstrudel, der Kleinstgegenstände anzieht und sie nur widerwillig wieder freigibt. Alte Schlüssel, Schnürsenkel, Kugelschreiber, Hustenbonbons vergangener Winter, angebrochene Taschentuchpackungen, Kassenbons, Überraschungs-Ei-Figuren von 1983 – die Schublade als Hort für zauberhaftes, kleinteiliges Gerümpel. Entweder wird sie nie aufgeräumt oder in ferner Zukunft als Ganzes entsorgt. Dazwischen gibt es nichts.
Außer vielleicht das Design und die Kunst. Man erinnere sich an »Chest of Drawers« von Tejo Remy, der 1991 Schubladen diverser Größen und Stil-Epochen mit kleinen Kästen versah, um dieses gestapelte Konglomerat mit Spanngurten zu umzurren und zum Designobjekt zu erklären. Heute ist das Ding Kunst, kann im New Yorker Museum of Modern Art bewundert werden und ist für schlanke 20.570 Euro zu erwerben. Auch Maler wie Paul Cézanne verewigten Schubladen in ihren Stillleben. Salvator Dalí versah auf seinem Gemälde »Die brennende Giraffe« Körperteile einer Frau surrealistisch mit Schubladen an der Brust und den Beinen. Von der Dame gibt es zwar in Museumsshops kleine Repliken für die Fensterbank, daraus aber ein echtes, angekitschtes Möbelstück zum machen – »Schatz, die Socken sind im Dalí!« – auf diese Idee kam bisher niemand. Zum Glück blieb die Idee bisher da, wo sie hingehört: in der Schublade.